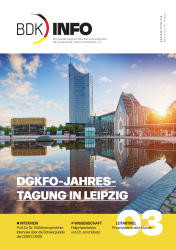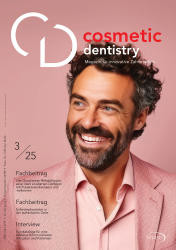Prophylaxe 14.08.2018
Mundhygiene: Wer rastet, der rostet
Rostbildung (Korrosion) an Eisen beginnt durch den Angriff einer Säure (Säurekorrosion) oder von Sauerstoff und Wasser auf die Metalloberfläche.1 Entsteht z. B. am Auto Rost, können sich kleine Löcher bilden oder Schweißnähte werden angegriffen. Weltweit verursacht die Verwitterung von Eisenwerkstoffen an Luft und Wasser zu Rost jährlich Schäden in Milliardenhöhe.1 Was man dagegen tun kann, ist ganz einfach: Rost entfernen und die Oberfläche durch Versiegelung vor Korrosion schützen – am besten mit Lack oder Öl.2 Das Gleiche gilt für unsere Zähne, und ganz besonders für Implantate. In dem Zusammenhang stellt sich automatisch die Frage nach den geeignet(st)en Hilfsmitteln, der schonenden Arbeitsweise und den Verfahren, die der Implantatträger auch regelmäßig nutzt.
Der schlimmste Feind in unserem Mund ist der Plaque-Biofilm. Wird der Zahnbelag nicht regelmäßig und gründlich entfernt, kann er den pH-Wert in der Mundhöhle herabsetzen und damit die Demineralisierung fördern: So wie Luft und Wasser an Eisen Rost entstehen lassen, bildet sich aus dem Stoffwechsel von Bakterien und Zucker ein säurehaltiger Biofilm, der den Zahnschmelz angreift und Mineralstoffe (u. a. Kalzium) herauslöst. Schlechte Mundhygiene birgt also immer das Risiko für Karies und Entzündungen. Dabei beginnt der Verlauf meist mit einer Gingivitis, die sich zu einer Parodontitis ausweiten kann, welche letztendlich im Verlust des Zahns endet. In solchen Fällen setzt man heute zunehmend Implantate. Doch auch diese müssen möglichst noch effektiver gepflegt werden, um einer Periimplantitis vorzubeugen.
Der vorliegende Fall zeigt, wie schnell sich dieser Prozess aufgrund unzureichender Pflege buchstäblich entzünden kann und wie wir im Rahmen einer internen Untersuchungsreihe den Patienten überzeugen konnten, mithilfe einer elektrischen Zahnbürste seine Mundhygiene und -gesundheit langfristig zu verbessern.
Fallbeispiel
Der 46-jährige Patient wird seit 2014 in unserer Praxis kieferchirurgisch behandelt. Zum Startzeitpunkt unserer internen Untersuchung wies die extraorale Situation keine besonderen Auffälligkeiten auf und war frei von Pathologien. Im dentalen Befund zeigte sich eine Gingivitis am in Regio 46 eingepflanzten Implantat (Abb. 1).
Das Anfärben mit TePe PlaqSearch™ hob mindestens 14 Tage alte Beläge hervor, die sich an den Prädilektionsstellen angesammelt hatten und nicht durch die häusliche Mundhygiene entfernt worden waren (Abb. 2 und 3).
Bleibt eine solche Gingivitis unbehandelt, führt das zu periimplantären Erkrankungen, die im schlimmsten Fall mit dem Verlust des Implantats enden. Etwa ein Drittel (32 Prozent) der Implantatpatienten leidet rund um die künstliche Zahnwurzel an einer Weichgewebsentzündung (Mukositis) ohne Knochenverlust. Fast 15 Prozent entwickeln eine mittelschwere bis schwere Periimplantitis, also eine Weichgewebsentzündung mit Knochenverlust von mehr als zwei Millimetern.3 Deshalb sind eine gut eingestellte Mundhygiene und regelmäßige Recalls aus therapeutischer Sicht unbedingt zu empfehlen.
Wer am Zahn nicht rosten will, sollte die Mundpflege optimieren
Neben der eigentlichen Behandlung sehen wir als Praxisteam vor allem in der Aufklärung der Patienten eine wichtige Aufgabe. Dazu gehört auch, sie zu einem verbesserten Plaque-Biofilm-Management zu motivieren. Mit adäquaten Hilfsmitteln steigert man in der Regel die Compliance. Deshalb empfehlen wir unseren Patienten, die noch die „gute alte“ Handzahnbürste verwenden, auf die elektrische Variante umzusteigen. Denn in neueren Studien konnte nachgewiesen werden, dass mit einer elektrischen Zahnbürste das Plaque-Biofilm-Management auf den Glattflächen der Zähne effizienter ist – und zusätzlich einen entscheidenden Effekt auf den subgingivalen Biofilm hat. Bei der mechanischen Reinigung zeigen elektrische Zahnbürsten also den besten Schutz gegen die Bakterienmatrix der Plaque.4
Generell empfehlen wir allen unseren Patienten, ihre individuelle Putztechnik mit den neuen technischen Hilfsmitteln systematisch zu üben. Entsprechende Anleitungen zum richtigen Umgang geben wir im Rahmen der Prophylaxesitzung. Um die technische Alternative zur Handzahnbürste zu testen und selbst die Unterschiede wahrnehmen zu können, gaben wir dem Patienten eine Schallzahnbürste (Philips Sonicare FlexCare Platinum) und ließen ihn damit die Quadranten I und IV selbst putzen (Abb. 4).
Schallunterstützte Mundhygiene für aktive Periimplantitisprävention
Schallzahnbürsten haben sich grundsätzlich bewährt, weil sie bauartbedingt bei zu hoher Druckanwendung ihre Schwingungsleistung reduzieren. So werden weder Gewebe noch Implantatoberfläche verletzt. Die Schallzahnbürsten von Philips sind zusätzlich mit einer automatischen Andruckkontrolle ausgestattet, die sofort ein Signal gibt, wenn der Anwender beim Zähneputzen unnötig festen Druck aufbaut. Außerdem minimieren die länglichen und flächig aufsetzenden weichen Bürstenköpfe (z. B. Philips Sonicare AdaptiveClean oder ProResults für gesundes Zahnfleisch) die Gefahr, das Weichgewebe zu irritieren. Vorteil der Schalltechnologie ist vor allem, dass eine gleichzeitig sanfte, aber überaus effektive Reinigungsleistung erzielt wird. Durch die präzise Kombination aus hoher Frequenz und besonders weitem Borstenausschlag reinigen diese Zahnbürsten nicht nur die Zähne sehr gründlich, sondern auch den gesamten Mundraum. Laut Herstellerangaben bewirken die 31.000 Seitwärtsbewegungen pro Minute eine dynamische Flüssigkeitsströmung, welche das Gemisch aus Speichel und Zahnpasta auch hinter und zwischen den Zähnen sowie entlang des Zahnfleischrandes verteilt. Auf diese Weise können während des Putzvorgangs auch Bakterien aus den Zahnzwischenräumen und Zahnsäumen entfernt werden.
Ergebnis
Unser Patient war schon nach der ersten Anwendung begeistert (Abb. 5) und nutzt seither die neue Schallzahnbürste für seine tägliche Zahn- und Mundpflege. Das Gefühl während des Putzens beschrieb er als sehr angenehm. Außerdem hob er hervor, dass die Reinigungsfähigkeit trotz des geringeren Andrucks sehr effektiv sei. Damit könne er sowohl das Implantat als auch die Zwischenräume besser reinigen.
Die vollständige Literaturliste gibt es hier.
Autor: Prof. Dr. Dr. Philipp Pohlenz
Der Fachbeitrag ist im Prophylaxe Journal erschienen.