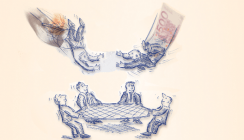Branchenmeldungen 09.10.2014
Und es geht doch – Vertrieb in einem Dentallabor
share
Vertrieb gehört zu jedem Unternehmen dazu. Manchmal macht es den Eindruck, als wäre diese Aufgabe gerade für die Dentalbranche eine besonders schwierige Herausforderung, die aus Sicht mancher Laborinhaber nicht zu lösen ist. Claudia und Thorsten Huhn sind seit über elf Jahren erfahrene Begleiter auf dem Weg des Auf- und Ausbaus eines langfristig erfolgreichen Vertriebs in Dentallaboren. Die ZT-Redaktion im Interview mit den beiden Gesellschaftern.
Was hat sich in den letzten Jahren im Hinblick auf Vertrieb geändert?
Thorsten Huhn: Vertrieb hat sich in den letzten 30 Jahren tatsächlich mehrfach und grundlegend gewandelt. Nach meiner Erfahrung ist etwa alle fünf Jahre eine zusätzliche Facette hinzugekommen, aber leider keine dafür weggefallen. Geschuldet ist dieser Umstand dem Faktor Mensch, der lieb gewonnene Gewohnheiten eben nur widerwillig über Bord wirft.
Aber der Reihe nach: Ganz klassisch stand einmal das Produkt und seine Leistungsfähigkeit im Mittelpunkt. So stehen viele Dentallabore auch heute noch auf dem Standpunkt, dass hervorragend hergestellter Zahnersatz für sich alleine sprechen sollte. Untermauert das der Zahntechniker zum Beispiel mit der Langlebigkeit der verwendeten Materialien oder der Präzision in der Herstellung, dann entspricht das dem vertrieblichen Ansatz von vor 30 Jahren.
Anfang der 90er-Jahre war immer noch das Produkt Kern der Vertriebsaktivitäten, allerdings stellte sich immer mehr die Integration eben jenes Produktes in den Arbeitsablauf des Zahnarztes in den Vordergrund. Die hervorragend gefertigte Krone, die ohne zusätzlichen Aufwand des Zahnarztes eingesetzt werden kann, wurde zum Matchwinner in der Argumentation. Im nächsten Schritt wurden Lösungen vertrieblich fokussiert. Lösungen konnten zum Beispiel in der Kombination von Produkt und Service des Dentallabors bestehen, wie zum Beispiel ein bedarfsorientierter Hol- und Bringdienst für zahntechnische Arbeiten.
Um die Jahrtausendwende wurden die Lösungen mit Mehrwerten untermauert. Wie stellt sich zum Beispiel der in Deutschland gefertigte Zahnersatz in der Gesamtheit seiner Kosten für den Zahnarzt dar, wenn Lieferzeiten und zusätzliche Aufwände bei Auslandszahnersatz mit eingepreist werden? Oder welche (finanziellen) Vorteile bietet der Vor-Ort-Service des Dentallabors beim Einsetzen einer schwierigen Arbeit? Diese Mehrwerte für den Zahnarzt spielen auch heute noch eine wichtige Rolle, allerdings werden sie ergänzt durch eine gute Beziehung zwischen Kunde und Lieferant. Der Vertrieb eines Dentallabors muss also heute Beziehungsmanagement von A–Z betreiben können, damit seine Mehrwertargumentation überhaupt Früchte trägt.
Und ganz aktuell wird Mitwirkung großgeschrieben. Der Zahnarzt ist im ständigen Dialog mit seinem Dentallabor, gibt Denkanstöße, spiegelt Patientenwünsche wider und beeinflusst so schließlich auch die Produkte und Leistungen seines Lieferanten. Für den Vertrieb bedeutet das, dass Offenheit, Transparenz und Bereitschaft zum permanenten Dialog oberste Priorität haben. Das komplette Thema des Social Media Marketings (Facebook und Co.) ist zum Beispiel eine Auswirkung des Wunschs nach Mitwirkung.
Kurzum: Wir haben in 30 Jahren einen Wandel vom Produktvertrieb zum Dialogvertrieb durchgemacht. Ich sagte eingangs, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist und sich deshalb der Produktvertrieb immer noch hartnäckig in den Köpfen hält. Und deshalb sind viele Dentallabore auch immer noch davon überzeugt, dass eine hervorragend gefertigte Arbeit für sich selbst sprechen muss. Tut sie aber nicht (mehr).
Muss ich als Labor überhaupt Vertrieb machen?
Claudia Huhn: Diese Frage lässt sich mit einem klaren „JA“ beantworten. Jedes Unternehmen, ob auf Wachstums- oder Bestandserhaltungskurs, muss Vertrieb für zusätzlichen Umsatz machen. Wie viel Umsatzbedarf besteht, ist von Labor zu Labor unterschiedlich und ergibt sich aus der jährlichen Umsatzplanung. Hier wird jeder Kunde auf seine Umsatztragfähigkeit hin beurteilt.
- a) Für wieviel Umsatz ist diese Zahnarztpraxis gut?
- b) Wie sicher ist dieser Umsatz im Hinblick auf Zahlungsfähigkeit und/oder altersbedingte Praxisaufgabe
Die Ergebnisse aus a) und b) zusammen ergeben das Umsatzpotenzial der aktuellen Kunden. Vorsichtige Umsatzplaner berücksichtigen nun noch Murphys Law: Einer geht immer. Betrachtet man die verlorenen Umsätze der vergangenen Jahre, so gibt es Verluste, die man auch unter objektiver und belastbarer Planung nicht hätte vorhersehen können. Ein Kunde wandert aus, zieht um, verstirbt ganz plötzlich oder Ähnliches. Bildet man den Durchschnittswert solcher unvorhersehbarer Verluste aus den letzten Jahren, so kann man auch dieser Position in der Umsatzplanung ausreichend Rechnung tragen. Dem Umsatzpotenzial steht der Umsatzbedarf des Unternehmens gegenüber. Wie viel Umsatz braucht das Labor, um all seinen finanziellen Verpflichtungen nachkommen zu können und auch noch ein Polster für „schwierige“ Zeiten anzulegen? Ergänzt man diese Zahl noch um die geplante Wachstumsrate, so ergibt sich der tatsächliche Umsatzbedarf des Unternehmens. Aus diesem Umsatzbedarf abzüglich des Umsatzpotenzials leitet sich nun der Vertriebsbedarf eines Dentallabors in Zeit und Inhalt ab. Genauer gesagt entsteht hier eine Aufgabe, für die jemand innerhalb des Unternehmens „Dentallabor“ die Verantwortung übernehmen muss. Und dafür benötigt diese Person nicht nur die entsprechenden vertrieblichen Kompetenzen, sondern auch die Zeit und die entsprechenden (Marketing-)Mittel. Erst diese Kombination macht einen professionellen Vertrieb möglich.
Gibt es heute noch Dentallabore, die ohne Außendienst Vertrieb machen?
Claudia Huhn: Ja, denn um erfolgreich Vertrieb in einem Dentallabor zu machen, braucht es nicht zwingend einen Außendienstmitarbeiter. Ob ein Dentallabor mit oder ohne Außendienst erfolgreich ist, das hängt von unterschiedlichen Faktoren ab.
Beginnen wir mit der Größe eines Dentallabors. Bis etwa fünfzehn Mitarbeiter wird es für ein Dentallabor schwierig sein, einen Vollzeit-Außendienstmitarbeiter finanziell aus dem Umsatz mitzutragen. Zwischen fünfzehn und zwanzig Mitarbeitern kann ein Dentallabor über die Anstellung eines Außendienstmitarbeiters nachdenken und ab zwanzig Mitarbeiter, so ist zumindest unsere langjährige Erfahrung, funktioniert organisierter und konsequenter Vertrieb nicht mehr ohne einen Außendienstmitarbeiter.
Der zweite Faktor ist der Vertriebsbedarf. Aus ihm lässt sich per einfachem Dreisatz ableiten, wie viel Vertrieb erforderlich, also wie viel Zeiteinsatz notwendig ist. Kann dieser Zeiteinsatz durch bereits bestehende Mitarbeiter (deren vertriebliche Kompetenz vorausgesetzt) bedient werden, so braucht es auch hier keinen Außendienst. Fehlt jedoch die Zeit hierfür, so wird es ohne Außendienst nicht gehen.
Der nächste Faktor ist die vertriebliche Kompetenz. Vertrieb ohne die entsprechenden Fähigkeiten zu machen, ist nicht nur ineffektiv, sondern kann im Extrem dem Unternehmen sogar mehr schaden als nutzen. Häufig wird auch schlicht der Bock zum Gärtner gemacht. Jemand bekommt die Verantwortung für dieses Thema, obwohl dieser Mitarbeiter weder hinreichend dafür qualifiziert noch motiviert ist.
Was spricht außerdem für die Installation eines Außendienstes?
Thorsten Huhn: Ich betrachte hier ein Labor, in dem der Chef heute selbst den Außendienst macht. Die Beziehungspflege zwischen Labor und Zahnarzt, der ständige Dialog, die Möglichkeiten der Kundenansprache über soziale Medien usw. sind aus meiner Sicht nicht mehr als Nebenaufgabe für den Laborinhaber zu bewältigen.
Erinnern Sie sich bitte, dass vor Jahren der Zahntechnikermeister seinen Fokus auf die Herstellung seines Produkts legen konnte und eben dieses ausreichte, um einen Kunden zu gewinnen und auch zu binden. Diese Symbiose funktioniert auch heute noch prima für langjährige und unbelastete Kundenbeziehungen.
Der neue Kundentypus will aber mehr. Er will nach wie vor erstklassige Produkte, die sich lückenlos in seinen Arbeitsablauf integrieren lassen und einen wirklichen Mehrwert bieten. Darüber hinaus will der neue Kundentypus und seine Meinung wertgeschätzt werden, er will bestenfalls sogar am Produktionsprozess teilhaben und so „seine“ Lösung einkaufen. Jetzt steht der Zahntechnikermeister und Laborinhaber, der ja in erster Linie für die Herstellung von 1a-Zahnersatz ausgebildet wurde, vor einer vertrieblichen Herausforderung, die bestenfalls nur einen deutlich größeren Teil seiner Zeit in Anspruch nehmen wird. Das ist aber genau die Zeit, die dann nicht mehr für die Produktion von Zahnersatz verwendet werden kann.
Ein weiterer Aspekt: Mit Blick auf eine klassische Aus- und Weiterbildung des Laborinhabers finden sich in der Regel nur wenige vertriebliche Elemente. Mit Kernfragen der Neukundenakquise oder der Bestandskundenbetreuung wird sich wenig und nicht selten auch widerwillig beschäftigt, obwohl das unternehmerische Aufgaben sind.
Mein Fazit lautet, dass ein Außendienst mit der Veränderung hin zum neuen Kundentypus zwingend notwendig ist. Ich möchte den Begriff „Außendienst“ dabei sehr weit fassen. Aus meiner Sicht gehören neben dem persönlichen Kontakt zum (potenziellen) Kunden vor Ort zum Beispiel auch Aufgaben des Social Media Marketings oder des Veranstaltungsmanagements dazu.
Welche Kompetenzen sollte ein solcher Mitarbeiter als Außendienstmitarbeiter mitbringen?
Thorsten Huhn: Wenn ich davon ausgehe, dass Beziehung, Mitwirkung und Dialog die entscheidenden vertrieblichen Faktoren sowohl in der Ansprache von neuen Kunden als auch in der Pflege von bestehenden Kundenbeziehungen sind, dann braucht es im Außendienst in erster Linie einen sozial kompetenten Menschen. Der Außendienstler muss
kurz gesagt kommunizieren, mit anderen zusammenarbeiten, sich selbst und andere motivieren und Konflikte managen können.
Das zweite Kompetenzfeld eines erfolgreichen Vertrieblers ist die Selbstkompetenz. Er sollte wissen, wo seine Stärken und Schwächen liegen. Er sollte in der Lage sein, authentisch und dennoch flexibel auf andere Menschen zuzugehen. Er sollte mit vertrieblichen Siegen sowie Niederlagen vernünftig umgehen können. Und er sollte mit Leidenschaft und Herzblut bei der Sache sein. Wichtig ist, dass nicht ausschließlich nach einem fachkompetenten Außendienstmitarbeiter geschaut wird. Ein guter Zahntechniker ist nicht zwingend auch ein guter Außendienstler. Manchmal verleitet zu viel Fachwissen sogar zum vertrieblichen Vorgehen von vor 30 Jahren: „... unsere Kronen sind so langlebig, weil wir folgendes Material verwenden ...“.
Lassen Sie mich noch anmerken, dass Fachkompetenz leichter zu erlernen ist als Sozial- oder Selbstkompetenz. Ich möchte damit sagen, dass das notwendige Fachwissen einem Branchenfremden leichter beizubringen ist, als beispielsweise einem ausgebildeten Zahntechniker die fehlende Kommunikationsfähigkeit.
Gibt es Faktoren, die den Erfolg eines Außendienstes positiv beeinflussen?
Claudia Huhn: Viele Dentallabore haben ja schon Erfahrungen mit Außendienstmitarbeitern gemacht. Typischerweise beginnt das Ganze auch hoch motiviert. Der Mitarbeiter wird gesucht, gefunden und für den Bereich „Neukundengewinnung“ eingestellt. Jeder, insbesondere die Person, die bis dato die Verantwortung für diese Aufgabe hatte, ist froh, dass dieses lästige Etwas nun endlich besetzt bzw. geregelt ist. Der neue Mitarbeiter erhält seine Arbeitsausstattung, soll sich im Labor umsehen und dann bitte raus zum Kunden. Erleichterung gepaart mit optimistischer Erwartung macht sich breit.
Jetzt geht es los, die Stimmung gleicht ein klein wenig einer Aufbruchsstimmung. Jetzt können die neuen Kunden kommen. Mit eben dieser Leichtigkeit geht auch der neue Mitarbeiter ans Werk. Neue Kunden für ein Dentallabor zu gewinnen, kann doch kein Hexenwerk sein; zwei, drei Wochen Vorarbeit und dann lassen sich sicherlich erste Ergebnisse beobachten. Und so tut jeder, was er tun soll. Der eine führt ein Dentallabor und der andere macht Kontakte zu potenziellen Neukunden. Wenn man sich trifft, meist zwischen Tür und Angel, dann tauscht man sich kurz aus und dann geht wieder jeder seiner Wege.
Die Zeit vergeht, die Ergebnisse, auf die man doch so gehofft hat, bleiben aus. Der elanvolle Gang des neuen Außendienstmitarbeiters wird täglich ein klein wenig schwerfälliger, der Kopf hängt von Woche zu Woche ein klein wenig mehr. Denn nach ein paar Wochen ist klar, jede Zahnarztpraxis hat ja ein Dentallabor und mit diesem ist diese Praxis auch noch zufrieden. Die Produkte, die man selbst im Labor hat, haben auch andere Labore. Man ist auf der Produktseite der totale Durchschnitt. Und so hagelt es tagtäglich immer die gleichen Antworten: Wir haben schon unser Labor, das macht unser Labor auch, wir arbeiten mit dem Ausland zusammen, unsere Patienten können sich teuren, deutschen Zahnersatz nicht leisten. Die Liste der Antworten ist beliebig und doch immer gleich. Jetzt beginnt die Ursachenforschung: Liegt es an der Region, sind die Zahnärzte hier besonders zäh oder besonders loyal? Liegt es am Portfolio des Labors? Könnte man erfolgreicher sein, wenn man noch innovativer wäre?
Über den Erfolg und Misserfolg eines Außendienstmitarbeiters entscheiden einige wenige Faktoren, die typischerweise wenig mit der Region und der in dieser befindlichen Zahnärzteschaft zu tun haben. Ebenso wenig hat der Erfolg in der Regel etwas mit dem Produktportfolio zu tun. Reduzieren wir die Faktoren auf ein Minimum, dann wird die Liste sehr überschaubar:
- a) Emotionale Intelligenz des Außendienstmitarbeiters – Ist er imstande, Vertrieb auf der Dialogebene zu machen?
- b) Vertriebskonzept – Auf welche Art und mit welchen Mitteln soll in ihrem Labor Neukundengewinnung gemacht werden?
- c) Steuerung des Außendienstmitarbeiters – Sind Sie als Führungskraft in der Lage, diesen Mitarbeiter so zu steuern, dass er Erfolg produzieren kann?
Jeder einzelne dieser Faktoren für sich gesehen ist essenziell wichtig. Wird einer davon vernachlässigt, reduzieren sich die Chancen auf Erfolg stark. Das heißt, hier gibt es nicht die Möglichkeit der Auswahl eins oder zwei aus drei, sondern die höchste Erfolgsquote ist nur bei drei aus drei zu realisieren.
Viele Labore mit Außendienstmitarbeiter starten völlig unbedarft in diese neue Aufgabe. Wenn die Ergebnisse ausbleiben, suchen sie häufig professionelle Unterstützung von extern. Fast immer finden wir die Ursache des fehlenden Erfolgs in der Abwesenheit. Auf was muss bei der Führung und Steuerung eines Außendienstes geachtet werden? Aus meiner Sicht sind folgende 10 Punkte wichtig für die Führung und Steuerung eines Außendienstmitarbeiters:
- Hören Sie zu! Ein offenes Ohr mit der Absicht, zu verstehen, was der Außendienstler meint, eröffnet vollkommen neue Möglichkeiten.
- Geben Sie Feedback! Kommunikation zu jeder Gelegenheit ist elementar. Denken Sie dabei an die Ausgewogenheit und den Situationsbezug.
- Coachen Sie! Entwickeln Sie die Potenziale Ihres Außendienstes und bauen Sie Selbstvertrauen auf, indem Sie ihn aktiv begleiten.
- Sorgen Sie für Ziele! Ein Mitarbeiter, der die Richtung nicht kennt, wird sich mit Sicherheit verlaufen.
- Kontrollieren Sie! Jede Aufgabe, die Sie an den Außendienst delegieren, wird nur dann erfüllt werden, wenn Sie die Zielerreichung überprüfen.
- Seien Sie Vorbild! Fahren Sie mit zum (potenziellen) Kunden und machen sich ein Bild von der Situation vor Ort.
- Seien Sie mutig! Blicken Sie über den Tellerrand. Scheuen Sie nicht das Risiko. Haben Sie auch den Mut zu unpopulären Maßnahmen.
- Feiern Sie Erfolge! Gute Leistungen und gute Ergebnisse spornen an. Zelebrieren Sie diese im Team.
- Managen Sie Ihr Personal! Neben einer guten Führung ist ein gutes Personalmanagement das A und O. Binden Sie Ihren Außendienst an sich und beurteilen Sie ihn regelmäßig.
- Lassen Sie sich keinen Affen aufbinden!
Nicht jede Aufgabe ist eine Führungsaufgabe. Herausheben möchte ich gerne den ersten Punkt noch einmal. Nutzen Sie jede Möglichkeit des Austauschs. Am besten planen Sie aber einen Nachmittag pro Woche, um die vergangenen Kundenbesuche zu reflektieren, die zukünftigen Besuche zu planen und die dedizierten Vertriebsaktivitäten und vor allem die Wochenziele festzulegen. Dann klappt das ja auch mit dem Außendienst.
Welche Faktoren sind für eine professionelle Bestandskundenbetreuung wichtig?
Claudia Huhn: Oft wird mir die Frage gestellt: „Was ist wichtiger Neukundengewinnung oder Bestandskundenbetreuung?“ Leider habe ich darauf keine Antwort im Sinne von Ausschließlichkeit. Fakt ist, ein Labor kann dauerhaft nur dann erfolgreich sein, wenn beides hervorragend funktioniert. Neue Kunden sichern den stetigen Zustrom an frischem Umsatz, der für Wachstum und den Ersatz von wegfallenden Kunden benötigt wird. Umsatz aus Bestandskunden sichert die gegenwärtige Existenz eines Unternehmens. Es ist einfacher, einen Kunden im Umsatz auszubauen, als einen neuen Kunden dazuzugewinnen.
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht liegt es nahe, zuerst die Umsätze bei Bestandskunden auszubauen, bevor man in neue Kunden investiert. Dies ist jedoch nur betriebswirtschaftliche Theorie: Ein Labor ist vertrieblich im Sinne seiner Ziele unterwegs, wenn beide Aufgaben professionell geplant, durchgeführt und kontrolliert werden. Anders als bei der Neukundengewinnung machen alle Dentallabore Bestandskundenbetreuung. Irgendwie zumindest, zumeist ohne Konzept, ohne Ziel und meist auch ohne Plan. Für eine professionelle und damit erfolgreiche Bestandskundenbetreuung sind folgende Faktoren maßgeblich:
1. Definition Bestandskunde: Welcher Kunde ist Ihr Bestandskunde, welcher ist es nicht?
Die Definition eines Zielkunden ist sowohl für die Neukundengewinnung als auch für die Bestandskundenbetreuung essenziell. Nur so hat man als Labor die Chance, seine wertvolle Zeit und Energie nicht mit Kunden zu verbringen, die gar nicht ins Portfolio passen. Hilfreiche Fragen können hier sein: Mit wem macht arbeiten Spaß und mit wem nicht? Wie viel Betreuung soll/darf ein Kunde in Anspruch nehmen? Wie viele Reklamationen können Sie sich als Labor leisten, also welcher Kunde ist kalkulatorisch positiv, welcher ist es nicht?
2. Ziele: Was wollen Sie mit welchem Kunden erreichen? Wie viel Potenzial steckt in welchem Kunden?
In der Regel ist der zahntechnische Umsatz einer Zahnarztpraxis gut zu schätzen, Sodass sich aus Ihrem Umsatz und dem geschätzten Gesamtumsatz der Praxis das Potenzial dieser Praxis ergibt. Bitte beachten Sie, dass die gesetzten Ziele auch realistisch sein sollten. Es ist nicht realistisch, aus einem C-Kunden kurzfristig einen A-Kunden zu machen. Was trotzdem nicht heißen soll, dass es solche Fälle nicht schon gegeben hätte.
3. Plan: Wie können Sie die gesetzten Ziele erreichen?
Betrachtet man einen einzelnen Kunden und setzt voraus, dass das, was Sie für diese Praxis tun, dieser Praxis genau diesen Umsatz wert ist, dann stellt sich die Frage: Was müssen Sie tun, um einen anderen, einen höheren Umsatz mit dieser Praxis zu erzielen? Welches andere Engagement, welchen anderen Service, welche andere Betreuung können Sie dieser Praxis anbieten, die dieser Praxis auch einen anderen, nämlich den von Ihnen geplanten Umsatz wert ist?
4. Zeit: Wie viel Zeit steht Ihnen für die Erreichung der gesetzten Ziele zur Verfügung?
Wie bei der Neukundengewinnung spielt die Zeit auch bei der Bestandskundenbetreuung eine wesentliche Rolle. Sie kann nur dann professionell sein, wenn für die geplanten Aktivitäten auch ausreichend Zeit zur Verfügung steht. In der Regel ist dies Zeit des Laborinhabers oder Laborleiters. Stellen Sie sich aber auch die Frage: Wenn Sie nicht ausreichend Zeit haben, wer kann Sie bei der Erreichung Ihrer Ziele unterstützen?
5. Tue Gutes und rede darüber: Kennen Ihre Kunden Ihr Produkt- und Serviceportfolio? Zu 100 Prozent?
Immer wieder machen wir im Gespräch mit Zahnarztpraxen die Erfahrung, dass diese gar nicht ausreichend über das komplette Portfolio ihres Labors informiert sind. So kann dann auch der Außendienst des Wettbewerbs locker mit einer vermeintlichen Neuigkeit in dieser Praxis punkten, weil die Praxis nicht wusste, dass in ihrem eigentlichen Labor dieses Produkt auch schon längst Einzug gehalten hat. Um sicherzustellen, dass alle Kunden über alle Produkte und alle Services informiert wurden, sollte dies ausführlich dokumentiert werden. Bitte beachten Sie: Es kann durchaus sein, dass Sie dem ein oder anderen Kunden das ein oder andere Produkt mehr als einmal schmackhaft machen müssen.
6. Jahresgespräche: Führen Sie Entwicklungsgespräche mit Ihren Kunden. Wo soll die Reise in der Praxis hingehen, wo können Sie unterstützen?
Einmal pro Jahr sollten Sie sich und Ihren Kunden eine kleine „planerische Auszeit“ gönnen. Begeben Sie sich mit Ihren Kunden gedanklich auf eine Planung der Zukunft. Erfahren Sie so, was Ihre Kunden bewegt, wo diese sich hinentwickeln wollen und wo Sie sich hier als Partner und nicht mehr nur als Lieferant positionieren können. Diese Einzelgespräche finden in Ruhe, ohne direkten Bezug zu einer Patientenarbeit statt.
7. Kundenbesuche: Wie oft sind Sie bei Ihren Kunden vor Ort?
Vermutlich sind Sie häufig bei Ihren Kunden vor Ort. Vermutlich allerdings häufig in Zusammenhang mit einer Kundenarbeit. Wenn Ihnen der Aufbau einer intensiven Beziehung zu Ihren Kunden wichtig ist, dann sollten Sie Ihre Bestandskunden mindestens einmal im Quartal, ohne einen direkten Bezug zu einer speziellen Patientenarbeit, aufsuchen. Nur so haben Sie die Chance, die Beziehung zu Ihren Kunden zu pflegen und zu intensivieren.
8. Aussagefähige Dokumentation: Dokumentieren Sie ausführlich Ihre Aktivitäten.
Wer schreibt der bleibt oder wer das Wissen hat, hat die Macht. Diese sicherlich etwas theatralischen Sprüche enthalten allerdings die volle Wahrheit. Nur mit einer ausführlichen und umfangreichen Dokumentation haben Sie als Labor die Chance, Ihre Kunden umfassend zu betreuen, weil Sie so jederzeit auf alle wichtigen Informationen zugreifen können.
Bitte denken Sie immer daran: Wenn zwischen Ihnen und Ihrem Kunden auf der Beziehungsebene Platz ist, sei es auch noch so wenig, dann bietet dieser Platz Raum für Ihren Wettbewerb. Ähnlich einem kleinen Haarriss in der Wand, der im Winter zuerst mit Wasser vollläuft und dann die Wand kaputtfrieren lässt.
Hat die professionelle Bestandskundenbetreuung Auswirkungen auf ein typisches Labororganigramm und wenn ja, welche?
Claudia Huhn: Mit zunehmender Automatisierung und damit einhergehender zunehmender Vergleichbarkeit der zahntechnischen Produkte rückt die emotionale Kundenbetreuung immer stärker in den Fokus. Dies bedeutet, dass Neukundengewinnung und auch Bestandskundenbetreuung immer zeitintensiver werden. Früher hat ein Laborinhaber die Kundenbetreuung und die Neukundengewinnung häufig in Joballianz locker nebenbei erledigt. Heute kann häufig weder das eine noch das andere von dieser Person alleine geschafft werden.
In einem auf den Kunden ausgerichteten Organigramm steht der Laborinhaber bzw. der Geschäftsführer oben und darunter befinden sich für den Neukundenbereich der Außendienst und für die Bestandskunden die technischen Kundenbetreuer.
Technische Kundenbetreuer betreuen einen Bestandskunden umfänglich. Nicht nur alle technischen Arbeiten werden von dem verantwortlichen technischen Kundenbetreuer bedient, insbesondere auch die emotionale Betreuung erfolgt durch diese Person, nachdem sich der Außendienst am Ende seiner Akquise aus dieser Beziehung „gestohlen“ hat.
Welche Fähigkeiten müssen diese sogenannten „technischen Kundenbetreuer“ haben?
Claudia Huhn: Technische Kundenbetreuer benötigen neben allen zahntechnischen Fähigkeiten, die notwendig sind, um alle Kundenarbeiten zu begleiten, vor allem empathische und kommunikative Fähigkeiten. Empathie sichert das individuelle Einstellen auf den einzelnen Kunden und dessen Zwischentöne, die kommunikativen Fähigkeiten sind für eine professionelle Zusammenarbeit notwendig. Gemeinsame Patientenbetreuung von der Beratung bis zu Eingliederung des Zahnersatzes, Entwicklungsgespräche mit dem Kunden, Stressgespräche mit der Praxis und natürlich auch das Vorstellen und Verkaufen neuer Laborprodukte und -services.
Seit drei Jahren bilden wir sogenannte Dentale Kundenmanager aus. Das sind technische Kundenbetreuer, die sich nicht mehr nur als Zahntechniker sehen, sondern vielmehr als Manager von Kundenbedürfnissen, seien sie technischer oder emotionaler Natur.
Wer zukünftig auf Bindung der Kunden über die Komponente „Mensch“ setzt, wird um die Installation von „Dentalen Kundenmanagern“ oder technischen Kundenbetreuern nicht umhinkommen.
Wie kann ein Dentallabor seine aktuellen vertrieblichen Herausforderungen lokalisieren?
Thorsten Huhn: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass vertriebliche Herausforderungen immer dann in den Fokus des Laborinhabers rücken, wenn irgendetwas Außergewöhnliches passiert ist. Das kann der Blick auf die Geschäftszahlen am Ende eines Geschäftsjahres sein, die sich negativ im Vergleich zum Vorjahr unterscheiden, aber auch der plötzliche und scheinbar unerklärbare Verlust eines umsatzstarken Zahnarztes. Die Bandbreite der möglichen Ereignisse ist naturgemäß groß, allen gemeinsam ist aber, dass sie bereits zu einer Änderung des Status quo geführt haben.
Bei wirtschaftlich gesunden Laboren lässt sich die Herausforderung sauber lokalisieren, ein Maßnahmenpaket schnüren und mit entsprechenden vertrieblichen Aktionen auch zielgerichtet gegensteuern. Häufig kommt jedoch die Erkenntnis, handeln zu müssen, in einer wirtschaftlich bereits schwierigen Situation. Vertrieb mit „dem Rücken an der Wand“ ist dann leider kein guter Ratgeber für herausragende Ergebnisse.
Daher halte ich es für immens wichtig, dass eine saubere und realistische Jahresplanung gemacht und diese ständig mit dem Status quo verglichen wird. Nur so lassen sich frühzeitig die richtigen Maßnahmen definieren und letztlich auch Krisen vermeiden. Um eine solche Planung aufsetzen zu können, sind u. a. die aktuellen Herausforderungen zu lokalisieren.
Für den Geschäftsführer oder Inhaber eines Labors ist das vertriebliche Jahresziel der wichtigste Taktgeber. Das kann qualitative und sollte quantitative Elemente haben. Wenn ich mein Eingangsbeispiel wieder bemühe, dann führt der Verlust eines umsatzstarken Zahnarztes zur erhöhten Kundenbindung bei den verbliebenen Bestandskunden oder zur Gewinnung von Neukunden, die mittelfristig das Umsatzdefizit ausgleichen können. Mit Zahlen hinterlegt heißt das dann: Durchführung von vier Kundenveranstaltungen im kommenden Kalenderjahr mit aktuellen Themen oder Gewinnung von drei Neukunden im kommenden Geschäftsjahr mit einem Leistungsumsatz von je 15.000 Euro.
Sind die Ziele in der Jahresplanung verewigt, ist die Frage nach dem „Wie?“ zu klären. Eine gute Hilfestellung ist hier ein Blick in die Vergangenheit. Was sind die Rezepte, die Ihnen in ähnlichen Situationen bereits geholfen haben? Was davon können Sie auch in Zukunft einsetzen? Was geht unter den heutigen Voraussetzungen nicht mehr oder nur noch mit starken Anpassungen? Natürlich sind auch Ihre aktuellen vertrieblichen Aktivitäten auf den Prüfstand zu stellen. Genügen die Maßnahmen, um die Ziele zu erreichen? Welche zusätzlichen Mittel müssen bereitgestellt werden, um den Plan zu erfüllen? Die letzte Frage zielt schon auf die Zukunft, den Planungshorizont des kommenden Geschäftsjahres. Damit werden die Weichen gestellt. Wie viel Bestandskundenbetreuung und wie viel Neukundengewinnung braucht es? Wer macht was? Wie hoch ist die Investition in die Zielerreichung?
Auch die Tatsache, dass wir uns vom Produktvertrieb schon lange verabschiedet haben und im Dialogvertrieb angekommen sind, zeigt vertriebliche Hürden auf, die es zu überwinden gilt. Wie kommuniziere ich mit meinen Kunden oder denen, die es noch werden sollen? Haben die Menschen, die im Labor Vertrieb machen, auch die notwendigen Fähigkeiten, um Zahnärzte zu gewinnen?
Mein Rat: Schreiben Sie die aktuellen Herausforderungen auf, formen Sie sie zu einem Plan und halten Sie sich daran.
Welche Marketinginstrumente werden für einen professionellen Vertrieb benötigt?
Thorsten Huhn: Letztlich alles, was ein professioneller Vertrieb braucht, um seine Ziele verfolgen zu können. Neben einer funktionierenden Produkt- und Servicepolitik, der Preis- und Leistungsgestaltung sind hier vor allem die Vertriebskanäle und die Kommunikation entscheidend.
Im Vertrieb vor Ort hängt der Erfolg z. B. vom Typ ab, der Vertrieb für ein Dentallabor macht. Ein einfaches Beispiel ist die Darstellung des Labors beim potenziellen Kunden. Der eine Vertriebler kommt mit Worten und Gesten aus, um die Alleinstellungsmerkmale aufzuzeigen, der andere wird sich lieber an einer Imagebroschüre oder ähnlichem entlanghangeln und damit gleichzeitig die Vorzüge seines Labors visualisieren. Ein Dritter wird auf einem leeren Blatt Papier im Dialog mit dem Zahnarzt genau die Dinge präsentieren, die im Gespräch als wichtig identifiziert wurden. Alle Wege haben ihre Vorteile, sie müssen nur typgerecht passen.
Unabdingbar ist heute sicher auch eine moderne Webseite. Sie dient zum einen als Visitenkarte im Netz, also schon fast zum guten Ton, zum anderen aber auch als Dialogmedium, um mit einem interessierten Seitennutzer in Kontakt zu treten. Eine gängige und technisch einfach zu realisierende Lösung ist beispielsweise die Einführung eines Weblogs, in dem das Labor aktuelle Themen mit der Möglichkeit zu kommentieren zum Dialog anbietet. Das verlangt ein wenig Disziplin beim Erstellen der Beiträge, lohnt sich aber hinsichtlich der Suchmaschinenoptimierung Ihrer Seite schon. Verwandt zum Thema Dialog sind auch die sozialen Medien zu nennen. Über Facebook und Co. können Inhalte sehr zielgerichtet kommuniziert werden. Vor allem wird über diese Medien eine jüngere Klientel angesprochen, für die der Austausch über Plattformen quasi zum Alltag gehört.
Ein nicht zu vernachlässigendes Marketinginstrument sind sicher auch Events. Sie bieten eine lokale Plattform für Bestandskunden und potenzielle Kunden gleichermaßen. Ich halte es für sehr wichtig, dass es sich bei diesen Veranstaltungen nicht um eine „Unterrichtseinheit“ handelt, also einen Vortragenden und viele Zuhörer, sondern ebenfalls um einen Dialog, bei dem das Labor als Gastgeber und Moderator fungiert und die Zahnärzteschaft untereinander zum Austausch angeregt wird. Ich habe punktuell in den Baukasten der Marketinginstrumente gegriffen. Es ließe sich noch viel zu Vertriebsmethoden oder Werbung sagen, aber wichtig war mir an dieser Stelle auf den Dialog in allen Facetten des Marketings hinzuweisen. Wir folgen dem Primat des Kunden, wir stellen uns der Diskussion, wir sind transparent und lassen unsere Kunden teilhaben an unserer Produkt- und Servicepolitik.
Wie werden Marketing und Vertrieb professionell miteinander verknüpft?
Thorsten Huhn: Vertrieb und Marketing sind grundsätzlich nicht zu trennen. Der Außendienst, der ohne die richtigen Marketinginstrumente zum Kunden geht, kämpft mit stumpfen Waffen. Ebenso sind typische Marketingmittel wie Werbung oder Events ebenfalls weniger nachhaltig, wenn sich z. B. nach der Versendung einer Einladung keiner ans Telefon setzt und im Gespräch die Bedarfslage beim Eingeladenen checkt.
Vertrieb und Marketing müssen also Hand in Hand gehen, um effektiv zu sein. Wichtig ist, dass die Unternehmensphilosophie, die eindeutige Positionierung des Dentallabors im Markt, maßgeblich die Ausgestaltung beider Facetten bestimmt. Ein etabliertes Labor mit einem Premiumportfolio wird anders auf einen potenziellen Neukunden zugehen als ein neuer Player im Markt, der mit günstigen Produkten wirbt. Auch der Wettbewerb bestimmt die Wahl der Vertriebsmethoden und die Art der Werbung eines Labors.
Machen Sie sich einen Plan, der Ihre Marketingmaßnahmen über einen Zeitraum von einem Jahr enthält. Beantworten Sie sich beispielsweise folgende Fragen: Wann machen Sie welche Veranstaltung? Wann versenden Sie die Einladungen zum Tag der offenen Tür? Wann besorgen Sie die Weihnachtskalender für Ihre Bestandskunden? Für welche Themen brauchen Sie Schaumodelle? Wann geht die neue Imagebroschüre in die Verteilung? Wann erscheint der nächste Blogartikel? Lassen Sie den Außendienst an der Erstellung des Plans mitwirken, denn er kennt die Bedarfe und Bedürfnisse Ihrer Kunden. Diese Planung gibt Ihnen außerdem eine Übersicht über die notwendigen Budgets und ist ein Handlungsleitfaden für den Außendienst.
Zusammenfassung
Vertrieb in einem Dentallabor ist keine exakte Wissenschaft, hat aber sehr viel mit einem durchdachten Plan und dessen Umsetzung zu tun. Für die Erstellung eines Plans wiederum bedarf es der Betrachtung des Status quo und der Auseinandersetzung mit der Frage „Wo will ich mit meinem Dentallabor hin, welche Ziele verfolge ich?“. Und genau bei dieser Frage gibt es häufig fragende Blicke oder pauschale Aussagen der Verantwortlichen. Aber genau hier setzt der richtige Vertrieb ein: In der Lücke zwischen dem IST-Zustand und dem SOLL-Zustand. Damit werden fromme Wünsche wie „mehr Umsatz“ oder „mehr Kundenzufriedenheit“ sichtbar und messbar gemacht. Konkrete quantitative oder qualitative Ziele, wie „Gewinnung von drei Neukunden im kommenden Geschäftsjahr mit einem Leistungsumsatz von je 15.000 Euro“ oder „Ausbau der Kundenzufriedenheit durch die Einführung von dialogorientierten Marketinginstrumenten, u. a. eines Weblogs“ sind nicht nur ein Teil einer durchdachten Planung, sondern auch wesentliche Elemente in der vertrieblichen Steuerung.
Kombiniert man die Planung mit einer professinellen Umsetzung, so ist auf die Ausbildung der Vertriebsverantwortlichen genauso Wert zu legen, wie auf die eingesetzten Marketinginstrumente. Wir wünschen Ihnen für beides ein glückliches Händchen, für eine saubere Planung ebenso wie für eine professionelle Umsetzung. Und sollten Sie eine helfende Hand für die Identifikation der Lücke zwischen IST und SOLL brauchen, dann sprechen Sie uns gerne an.




 DD cube X® ML
DD cube X® ML  DD Incisal X
DD Incisal X  DD Art Elements – Effektfarben
DD Art Elements – Effektfarben  DD Solid Link
DD Solid Link  DD Bio Splint FLEX
DD Bio Splint FLEX  DD Bio Splint P HI
DD Bio Splint P HI  DD cube case
DD cube case  DD Shade Guide
DD Shade Guide  Asiga Ultra 50
Asiga Ultra 50  THERMEO® SO
THERMEO® SO