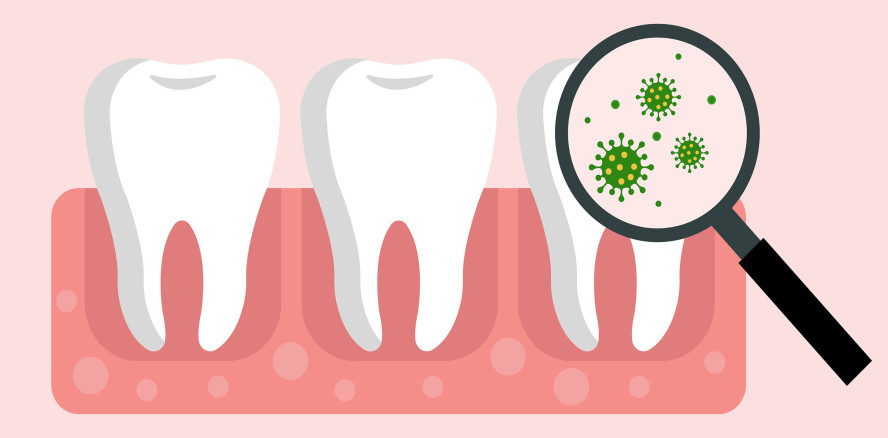Wissenschaft und Forschung 17.01.2023
Diese Bakterien kommen bei oralen Infektionen vor
share
Forscher des Karolinska Institutet in Schweden haben die Bakterien identifiziert, die am häufigsten bei schweren oralen Infektionen vorkommen. Die Studie wurde kürzlich in der Fachzeitschrift Microbiology Spectrum veröffentlicht.
Frühere Studien haben bereits klare Zusammenhänge zwischen schlechter Mundgesundheit und Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Alzheimer festgestellt. Auch die schwedische Forschungsgruppe konnte in vorherigen Untersuchungen bereits beweisen, dass das Vorkommen oraler Bakterien in der Bauchspeicheldrüse mit der Entstehung von Bauchspeicheldrüsentumoren einhergeht. Es gibt jedoch bis jetzt nur wenige Längsschnittstudien, die identifizieren, welche Bakterien in infizierten Mund- und Kieferregionen vorkommen.
Forscher haben nun Proben analysiert, die zwischen 2010 und 2020 am Karolinska University Hospital in Schweden von Patienten mit schweren oralen Infektionen gesammelt wurden. Die Studie wurde mit Proben von 1.014 Patienten (469 von Frauen und 545 von Männern) mithilfe eines Massenspektrometer durchgeführt. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass die häufigsten Bakterienstämme Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria und Actinobacteria waren, während die häufigsten Gattungen Streptococcus spp., Prevotella spp. und Staphylococcus spp. waren.
„Unsere Ergebnisse liefern neue Einblicke in die Diversität und Prävalenz schädlicher Mikroben bei oralen Infektionen“, so Professor Sällberg Chen von der Abteilung für Zahnmedizin am Karolinska Institutet. „Der Befund ist nicht nur für die Zahnmedizin von Bedeutung, er hilft uns auch, die Rolle von Zahninfektionen bei Patienten mit Grunderkrankungen zu verstehen.“
Die aktuelle Studie ist Teil der Doktorarbeit von Khaled Al-Manei, dessen nächster Schritt es ist, eine epidemiologische Studie zu Pilzinfektionen im Mund durchzuführen. Die folgende Studie zielt darauf ab, neue Pilze und Mikroben zu identifizieren und zu verstehen.
Quelle: Karolinska Institutet, © ZWP online