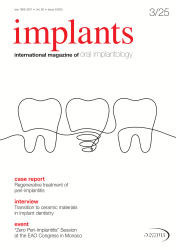Prophylaxe 02.05.2024
Interdisziplinäre Ansätze zur Diagnostik und Behandlung von Mundtrockenheit
share
Im Kontext der oralen Gesundheit stellt die Mundtrockenheit eine Herausforderung dar, die sowohl für Betroffene als auch für medizinische Fachkräfte oft schwer zu handhaben ist. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden die Begriffe Xerostomie und Hyposalivation oft fälschlicherweise gleichgesetzt, jedoch können Xerostomie und Hyposalivation nicht als Synonyme betrachtet werden. Xerostomie beschreibt speziell die subjektive Wahrnehmung des trockenen Mundes beim Patienten – ein Zustand, der auch ohne nachweisbare Speichelminderung auftreten kann. Im Gegensatz dazu erlaubt die Hyposalivation eine klinische und objektive Diagnose durch Messung der Speichelfließraten.
Mundtrockenheit ist ein weitverbreitetes Phänomen, dessen Prävalenz in jüngster Zeit neu erfasst wurde. Neuere Erkenntnisse, die durch groß angelegte Übersichtsarbeiten gestützt werden, haben die ursprünglich berichtete Prävalenz von etwa 20 % revidiert. Nach diesen umfassenden Analysen wurde die Prävalenz von Mundtrockenheit auf 30 % bei Patienten ab 60 Jahren korrigiert.1 Diese Revision stellt einen signifikanten Anstieg dar und unterstreicht die klinische Relevanz dieser Erkrankung. Neuere Studien zeigen zudem geschlechtsspezifische Unterschiede in der Prävalenz von Hyposalivation. Auffallend ist, dass Frauen deutlich häufiger betroffen sind als Männer. Dies wird auf eine Reihe von Faktoren zurückgeführt, darunter hormonelle Unterschiede, spezifische Gesundheitsprobleme und möglicherweise die höhere Lebenserwartung von Frauen. Insgesamt sind die Auswirkungen von Mundtrockenheit umfangreich und können die Lebensqualität der Betroffenen erheblich beeinträchtigen. Häufig manifestiert sich die Erkrankung in Form von Sprechschwierigkeiten, Dysphagie oder erhöhtem Risiko für Karies und orale Infektionen.
Trotz der hohen Prävalenz und der ernsthaften gesundheitlichen Folgen bleibt die Erkrankung oft unerkannt und wird dementsprechend nicht adäquat behandelt. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, das Bewusstsein für diese Erkrankung zu schärfen und effizientere Strategien zur Prävention, Diagnostik und Therapie von Mundtrockenheit zu entwickeln. [Abb. 1]
Die Bedeutung des Speichels
Verringerter Speichel wird häufig unterschätzt, bis sich sein Fehlen in klinischen Symptomen äußert. Speichel ist ein hochkomplexes biologisches Medium und übernimmt eine Vielzahl essenzieller Funktionen in der oralen Homöostase, die weit über die alleinige Hydratation der Mundhöhle hinausgehen.2
Die Speichelsekretion wird zum großen Teil von drei großen paarig angelegten Drüsen übernommen. Die Glandula parotidea ist die größte von ihnen und produziert ausschließlich serösen Speichel. Sie liegt vor und unter dem Ohr und erstreckt sich vom Jochbogen bis zum Kieferwinkel. Die Glandula submandibularis ist beidseits im Unterkieferwinkel zwischen dem Unterkiefer und dem Musculus digastricus lokalisiert und produziert seromukösen Speichel. Ergänzt wird dieses Duo durch die Glandula sublingualis, die Unterzungenspeicheldrüse, die hauptsächlich mukösen Speichel produziert. Diese Hauptspeicheldrüsen werden von etwa 600 bis 1.000 kleineren Drüsen im Mund- und Rachenbereich unterstützt, sodass insgesamt eine tägliche Speichelproduktion von etwa 0,5 bis 1 Liter erreicht wird. Interessanterweise unterliegt die Speichelproduktion einem zirkadianen Rhythmus und kann durch emotionale Faktoren, Kauaktivität und Geschmacksreize moduliert werden.
Fazit
Speichel ist eine komplexe Matrix, die überwiegend aus Wasser (ca. 99,5 %) und verschiedenen anorganischen und organischen Komponenten besteht. Anorganische Bestandteile wie Calcium, Phosphat und Fluorid sind für die kariesprotektiven Eigenschaften des Speichels verantwortlich. Sie tragen zur Remineralisation der Zahnhartsubstanzen bei. Der Speichel nutzt seine Puffersysteme (Bikarbonat und Phosphat), um Säuren zu neutralisieren und so den pH-Wert schnell (innerhalb von ca. 30 Minuten bei ausreichender Speichelmenge) in den Normbereich zu bringen.3
Organische Bestandteile wie IgA-Antikörper gegen Streptococcus mutans, Lysozym und Lacotoferrin wirken direkt antibakteriell und damit auch antikariogen. Darüber hinaus leitet der Speichel die Verdauung ein, indem die Amylase Stärke und Glykogen spaltet, während die Muzine (Glykoproteine) für die Viskosität des Speichels sorgen und damit das Schlucken und Sprechen erleichtern. [Abb. 2-4]
Auslöser der Mundtrockenheit sind vielfältig
Trotz der wichtigen Rolle, die diese Komponenten spielen, müssen auch die Risiken im Auge behalten werden, die mit altersbedingten Veränderungen in den Speicheldrüsen einhergehen.
Auslösende Faktoren der Mundtrockenheit sind vielfältig und in der folgenden Tabelle ohne Anspruch auf Vollständigkeit zusammengefasst: [Abb. 5]
Heutzutage wissen wir, dass die altersbedingte Degeneration der Parenchymstrukturen der Speicheldrüsen potenziell zu einer Beeinträchtigung ihrer Funktion führen kann.
Außerdem machen sich mit fortschreitendem Alter beträchtliche Veränderungen in den Sekretionsmustern und Hormonspiegeln der Speicheldrüsen bemerkbar, die sowohl positive als auch schädliche Auswirkungen haben können.
Zusätzlich zu diesen strukturellen Veränderungen führt der Alterungsprozess auch zu physiologischen Veränderungen im Körper, die eine Dysfunktion der Speicheldrüse verursachen können. Dazu zählen eine Reduktion der Rezeptoranzahl, die die Intensität der Speicheldrüsenstimulation verringert, verminderte Durchblutung, Störungen der neuronalen Übertragung sowie altersbedingte Krankheiten und Medikamenteneinnahme bei Senioren, die alle zusammen die Funktion der Speicheldrüsen beeinträchtigen können.
Diabetes mellitus spielt eine wesentliche Rolle bei der Entstehung von Mundtrockenheit
Neben dem Sjögren-Syndrom kann auch eine andere weitverbreitete chronische Stoffwechselerkrankung, Diabetes mellitus, eine wesentliche Rolle bei der Entstehung von Mundtrockenheit spielen. Bei Diabetikern stört eine erhöhte Glukosekonzentration im Blut die Zellfunktion und das osmotische Gleichgewicht in den Speicheldrüsen, was zu einer verminderten Speichelproduktion führen kann.
Die übermäßige Glukose im Blut kann eine osmotische Dysbalance verursachen, die dazu führt, dass Wasser aus den Zellen gezogen wird, um den erhöhten Glukosespiegel auszugleichen. Dies kann eine Dehydration der Zellen in den Speicheldrüsen verursachen und dadurch die Menge an produziertem Speichel verringern. Darüber hinaus kann ein hoher Blutzuckerspiegel die Zellfunktionen beeinträchtigen und die Fähigkeit der Speicheldrüsenzellen, Speichel zu produzieren, verringern.
Außerdem kann die chronische Hyperglykämie die autonome Nervenregulation der Speicheldrüsen beeinträchtigen.21 Die autonomen Nerven sind für die Feinregulation der Speichelproduktion verantwortlich und ihre Schädigung kann den normalen Speichelfluss stören. Hohe Blutzuckerwerte können somit zu einer Schädigung der Nerven (Neuropathie) führen. Dies beeinträchtigt die Speicheldrüsen, auf Signale zur Speichelproduktion zu reagieren.
Zudem kann die Polyurie, eine häufige Komplikation bei schlecht eingestelltem Diabetes, zu einem erhöhten Flüssigkeitsverlust führen.22 Die überschüssige Glukose veranlasst die Nieren, durch vermehrtes Urinieren die Glukose aus dem Körper zu entfernen. Diese erhöhte Urinproduktion kann zu Dehydratation führen, die den Körper dazu veranlasst, Flüssigkeit aus verschiedenen Geweben, einschließlich der Speicheldrüsen, abzuziehen, was zu einer verminderten Speichelproduktion führt.
Da sowohl Hyperglykämie als auch Polyurie bei schlecht eingestelltem Diabetes zur Mundtrockenheit beitragen können, ist eine gute Diabeteseinstellung entscheidend, um die Symptome zu lindern. Eine gute Blutzuckereinstellung kann die Glukosewerte im normalen Bereich halten und dadurch die Zellfunktion und das osmotische Gleichgewicht in den Speicheldrüsen aufrechterhalten. Dies kann die Speichelproduktion verbessern und die bestehende Mundtrockenheit lindern. Darüber hinaus kann eine gute Blutzuckereinstellung die Entwicklung einer diabetischen Neuropathie verhindern oder verzögern, was dazu beitragen kann, die autonome Nervenregulation der Speicheldrüsen zu schützen und die Speichelproduktion aufrechtzuerhalten.
Schließlich ist zu beachten, dass Mundtrockenheit bei Diabetikern nicht nur die Lebensqualität beeinträchtigen, sondern auch das Risiko für Mundgesundheitsprobleme wie Karies, Mundinfektionen und Parodontalerkrankungen erhöhen kann. Daher ist es wichtig, das Bewusstsein für Mundgesundheit bei Diabetikern zu schärfen und sie zu regelmäßiger Mundhygiene und zahnärztlichen Untersuchungen zu ermutigen, um die Mundgesundheit zu verbessern.
Rauchen beeinträchtigt die Speicheldrüsenfunktion
Neben dem Alter und physiologischen Veränderungen spielt auch das Rauchen eine bedeutsame Rolle bei der Beeinträchtigung der Speicheldrüsenfunktion. Tabakrauch enthält mehr als 7.000 chemische Verbindungen, sowohl in gasförmiger als auch in partikelförmiger Phase, die auf unterschiedliche Weise auf die Speicheldrüsen und ihre Funktion einwirken können. Einige dieser Verbindungen wie polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAKs), Aldehyde und Ketone sind für ihre toxischen, kanzerogenen und mutagenen Eigenschaften bekannt.4 Bei längerer Exposition können diese Substanzen den Zellstoffwechsel der Speicheldrüsenzellen stören und eine oxidative Stressreaktion auslösen,5 welche die DNA, Proteine und Lipide der Zellen schädigt und letztlich zu einer Beeinträchtigung der Speicheldrüsenfunktion führen kann.6
Nikotin, einer der Hauptbestandteile des Tabakrauchs, hat eine weitreichende Wirkung auf das autonome Nervensystem, das die Speicheldrüsenfunktion reguliert.7 Nikotin wirkt als Agonist an den nikotinischen Acetylcholinrezeptoren (nAChRs), die sich auf den Ganglienzellen des autonomen Nervensystems befinden,8 und kann eine sympathische Dominanz induzieren, die die Speichelproduktion hemmt.9 Dies führt zu einer verminderten Speichelproduktion und damit zu Mundtrockenheit.
Darüber hinaus wirkt Nikotin vasokonstriktorisch.10 Dies reduziert den Blutfluss zu den Speicheldrüsen und kann deren Sauerstoff- und Nährstoffversorgung einschränken, was wiederum deren Funktion und Speichelproduktion beeinträchtigt.11
Die ständige Belastung durch Tabakrauch führt außerdem zu einer chronischen Entzündungsreaktion in der Mundhöhle.12 Das Einatmen des heißen und reizenden Rauchs aktiviert das Immunsystem und führt zur Freisetzung von Entzündungsmediatoren wie Zytokinen und Chemokinen.13 Diese Entzündungsreaktion kann die Speicheldrüsen weiter schädigen und ihre Funktion beeinträchtigen,14 was wiederum zu Mundtrockenheit führt.15
Autoimmunerkrankung: Sjögren-Syndrom
Neben den Auswirkungen des Rauchens gibt es andere Krankheiten, die die Funktionalität der Speicheldrüsen beeinträchtigen können, wie das Sjögren-Syndrom.
Das Sjögren-Syndrom ist eine hochkomplexe, multifaktorielle Erkrankung, die zahlreiche Körperregionen, insbesondere exokrine Drüsen, einschließlich der Speicheldrüsen, betrifft.16 Als chronische systemische Autoimmunerkrankung ist das Sjögren-Syndrom durch fehlerhafte Reaktionen des Immunsystems gekennzeichnet, das gesundes Gewebe fälschlicherweise als fremd identifiziert und bekämpft. Das Ergebnis dieses fehlerhaften Prozesses ist eine fortschreitende Invasion von Lymphozyten, einer Untergruppe der Leukozyten, in die exokrinen Drüsen. Dieser autoimmunologische Angriff führt letztlich zu einer stetigen Degradierung des Drüsengewebes.17
Die Lymphozyteninfiltration führt zu einer Entzündung und Schädigung der exokrinen Drüsen, infolge derer die Speichelsekretion beeinträchtigt wird, was zu Mundtrockenheit führt. Darüber hinaus ist eine verminderte Tränenproduktion (Xerophthalmie) charakteristisch für das Sjögren-Syndrom, da auch die Tränendrüsen Ziel der Krankheitsprozesse sind.
Neben den genannten Mechanismen tragen weitere Faktoren zur Pathogenese des Sjögren-Syndroms und der daraus resultierenden Xerostomie bei. Dazu gehören die Bildung von Autoantikörpern (Aak), die gegen die Speicheldrüsen gerichtet sind, sowie die übermäßige Freisetzung von Entzündungszytokinen.18
Bei Patienten mit Sjögren-Syndrom können sich diese Autoantikörper gegen die Zellen der Speicheldrüsen richten und zu einer weiteren Schädigung und Beeinträchtigung der Drüsenfunktion führen.
Bei der Untersuchung des Sjögren-Syndroms fand man erhöhte Konzentrationen von Metaboliten wie Cholin, Taurin, Alanin, Glycin, Butyrat, Phenylalanin und Prolin im Speichel der Patienten. Es wurde auch festgestellt, dass eine geringere Speichelflussrate mit erhöhten Konzentrationen von Cholin und Taurin korreliert.
Weitere Studien ergaben eine eingeschränkte Vielfalt des Speichelmetaboloms bei Patienten mit Sjögren-Syndrom mit einer Reduktion von Metaboliten, hauptsächlich Aminosäuren und Kohlenhydrate.19 Der Metabolit Phenylacetat wurde als neuer Biomarker für Parodontitis identifiziert, dessen Konzentration positiv mit der Tiefe der Parodontaltaschen in allen Altersgruppen assoziiert ist.20
Parkinson: Doppelbelastung durch Krankheitsbild und Medikation
Parkinson ist eine neurodegenerative Erkrankung, die insbesondere durch einen progredienten Mangel an Dopamin gekennzeichnet ist, einem Neurotransmitter, der für die Signalübertragung zwischen den Nervenzellen notwendig ist.23
Die Parkinson-Krankheit kann die autonome Nervenregulation der Speichelproduktion beeinflussen und dadurch Mundtrockenheit verursachen.24 Insbesondere der Verlust von dopaminergen Neuronen in bestimmten Regionen des Gehirns, die für die Regulation der Speichelproduktion verantwortlich sind, kann zu einer verminderten Speichelproduktion führen. Außerdem können Anticholinergika, die zur Behandlung der Parkinson-Krankheit eingesetzt werden, Mundtrockenheit als Nebenwirkung haben.
Darüber hinaus kann Parkinson zu Dysphagie (Schluckstörungen) führen, was wiederum durch reduzierte Speichelfließraten negativ beeinflusst wird. Die Dysphagie mit einer häufig bestehenden Hypomimie führt unter anderem zum Drooling, also einem Herauslaufen von Speichel aus dem Mund. Dies kann auftreten, obwohl objektiv gemessen niedrige Speichelfließraten gemessen werden. Es ist bekannt, dass Mundgesundheit und Speichelfließraten bei Menschen mit Parkinson vermindert sind, im Vergleich zu gleichartigen gesunden Studienteilnehmern. Daher ist es wichtig, Patienten mit Parkinson für die erhöhten Risiken einer sich verschlechternden Mundgesundheit zu sensibilisieren und auf die Auswirkungen der Erkrankung und Medikation auf die Speicheldrüsen und Mundgesundheit frühzeitig zahnmedizinisch zu reagieren.25
Systemische Infektionskrankheiten
Zu guter Letzt können systemische Infektionskrankheiten wie HIV/AIDS und Hepatitis C negative Effekte haben. Bei diesen Erkrankungen können die Speicheldrüsen durch eine direkte virale Invasion von den Viren befallen und geschädigt werden, was zu einer verminderten Speichelproduktion führt.26
Darüber hinaus können Therapien zur Behandlung dieser systemischen Infektionskrankheiten, insbesondere antiretrovirale Medikamente und Interferon-basierte Therapien, erhebliche Nebenwirkungen haben, einschließlich einer Beeinträchtigung der Speicheldrüsenfunktion. Diese Nebenwirkungen können somit auch zur Entstehung der Mundtrockenheit beitragen.26
Bei Patienten mit HIV/AIDS besteht zudem das Risiko von opportunistischen Infektionen oder Tumoren, die sich aufgrund der geschwächten Immunabwehr des Körpers entwickeln können.27 Trotz der schwerwiegenden Auswirkungen systemischer Infektionskrankheiten auf die Mundgesundheit wird diese häufig vernachlässigt, was jedoch drastische Folgen haben kann, da sie sich nicht nur auf die allgemeine Gesundheit, sondern auch auf die Lebensqualität der Patienten auswirkt.
Wechselwirkungen durch Polypharmazie
Die bereits diskutierten Erkrankungen und physiologischen Alterungsprozesse stellen nur einen Teil der Herausforderungen im Hyposalivations-Management dar. Möglicherweise wichtigster Faktor ist die steigende Prävalenz der Polypharmazie insbesondere in höheren Lebensaltern. Polypharmazie ist durch die Verabreichung von fünf oder mehr Medikamenten charakterisiert.28 Mit dem Voranschreiten des Alters wird auch das Auftreten von Multimorbidität häufiger, was dazu führt, dass ältere Menschen tendenziell mehr Medikamente einnehmen. Epidemiologische Untersuchungen unter Senioren im Alter von 70 Jahren und älter (in Pflegeeinrichtungen) dokumentieren eine Polypharmazie-Prävalenz von 36 %, wobei ältere Altersgruppen höhere Raten aufweisen.29 Insbesondere in der stationären Altenpflege sind Polypharmazie-Prävalenzen von 73 % dokumentiert (mit der Erkenntnis, dass einer von fünf Bewohnern 10 oder mehr Medikamente einnimmt und kein Bewohner ohne Medikation ist).30 Die am häufigsten verschriebenen Medikamente sind Antihypertensiva, Analgetika und Antirefluxmittel.
Im Rahmen der weitverbreiteten Polypharmazie sind insbesondere Anticholinergika relevante Medikamente, die die Speichelproduktion beeinflussen. Anticholinergika sind eine Klasse von Medikamenten, die die Wirkung des Neurotransmitters Acetylcholin in bestimmten Teilen des Nervensystems blockieren. Beispiele für Anticholinergika sind Medikamente wie Atropin, Scopolamin und einige Antihistaminika wie Diphenhydramin. Im Zusammenhang mit Mundtrockenheit beeinflussen Anticholinergika die Wirkung von Acetylcholin an den muskarinischen Acetylcholinrezeptoren (mAChRs) auf den Speicheldrüsenzellen. Anticholinergika verhindern die Stimulation dieser Rezeptoren, was zu einer verminderten Speichelproduktion und Mundtrockenheit führt.24
Eine weitere Medikamentenklasse, die im Kontext der Polypharmazie oft zum Einsatz kommt und die Speichelproduktion reduzieren kann, sind Sympathomimetika. Beispiele sind Pseudoephedrin, Phenylephrin und bestimmte Bronchodilatatoren wie Salbutamol. Im Zusammenhang mit den Speicheldrüsen wirken Sympathomimetika auf die adrenergen Rezeptoren, die sich auf den Speicheldrüsenzellen befinden. Die Stimulation dieser Rezeptoren führt zu einer Vasokonstriktion, die die Blutzufuhr zu den Drüsen und damit die Speichelproduktion reduziert.31
Nicht zuletzt sind auch Diuretika, die häufig verschrieben werden, für ihre potenzielle Beeinträchtigung der Speichelproduktion bekannt. Eine Stoffklasse, die die Ausscheidung von Salz und Wasser aus dem Körper über die Nieren steigert. Beispiele sind Furosemid, Hydrochlorothiazid und Spironolacton. Durch die vermehrte Ausscheidung von Wasser und Elektrolyten kann es zu einer Dehydratation kommen, die zu einer verminderten Speichelproduktion führen kann.32
Zusammenfassend beeinflussen diese Medikamentenklassen die Speichelproduktion durch eine Kombination aus direkter Beeinflussung der Speicheldrüsen und indirekter Beeinflussung des allgemeinen Flüssigkeitshaushaltes des Körpers. Es ist daher wichtig, bei der Verschreibung dieser Medikamente das Risiko einer Mundtrockenheit zu berücksichtigen und geeignete Maßnahmen zur Prävention und Behandlung zu ergreifen. Zusätzlich ist in den letzten Jahrzehnten ein Trend erkennbar, der die steigende Verschreibungsmenge widerspiegelt. Obwohl die Anzahl der von einem Individuum eingenommenen Medikamente in vielen Fällen vollkommen angemessen und sicher sein mag, ist die Polypharmazie dennoch ein möglicher Risikofaktor für arzneimittelinduzierte Schäden wie erhöhte Sturzgefahr, kognitiven Verfall, Delir, Harnverhalt, Gebrechlichkeit und Mundtrockenheit.33,34 In Anerkennung der Risiken der Polypharmazie hat sich in den letzten Jahren die Praxis der Verordnungsreduktion entwickelt, ein geplanter und überwachter Prozess zur Reduzierung der Dosis oder des Absetzens von Medikamenten, die möglicherweise schädlich sind oder keinen Nutzen mehr bringen.
Weitreichende Auswirkungen auf die Mundgesundheit
Veränderungen in der Speichelsekretion haben weitreichende Auswirkungen auf die Mundgesundheit. Die Verringerung oder der Verlust des Speichelflusses beeinträchtigt nicht nur das orale Wohlbefinden, sondern kann auch zu einer Reihe von Mundgesundheitsproblemen führen, einschließlich Halitosis, Schwierigkeiten beim Kauen und Schlucken und Problemen mit der Prothesenretention.35 In Studien wurde gezeigt, dass ein verminderter Speichelfluss das Kariesrisiko erhöht, da die physikalische Reinigungs- und Pufferkapazität des Speichels fehlt.36 Dieses Risiko ist nicht auf ältere Menschen beschränkt, sondern kann auch in jüngeren Jahren auftreten, insbesondere bei Asthmapatienten unter Behandlung.
Darüber hinaus berichten Patienten häufig über ein anhaltendes Gefühl von Trockenheit und Unwohlsein im Mund.37 Weitere Manifestationen sind Schwierigkeiten beim Schlucken (Dysphagie), insbesondere beim Verzehr von trockener oder zäher Nahrung, und beim Sprechen (Dysphonie), die auf eine verminderte Benetzung der Mundhöhle zurückzuführen sind. Zusätzlich klagen einige Patienten über Durstgefühl, das die Patienten dazu veranlasst, mehr zu trinken, um die Mundtrockenheit zu lindern.38 Halitosis als Nebenerscheinung der Erkrankung ist für viele Patienten unangenehm. Dieses Unbehagen wird durch weitere Symptome wie Schmerzen und Risse in den Mundwinkeln, veränderte oder verminderte Geschmackswahrnehmung und einer allgemeinen Empfindlichkeit im Mund verstärkt.
Neben den körperlichen Symptomen kann Xerostomie auch erhebliche psychosoziale Auswirkungen haben. Die Betroffenen können sich in sozialen Situationen aufgrund von Mundgeruch und Sprechschwierigkeiten unwohl fühlen. Dieser Zustand kann zu sozialer Isolation, verminderter Lebensqualität und emotionalen Belastungen wie Depressionen und Angstzuständen führen.39,40 Darüber hinaus begünstigt die Erkrankung das Gefühl anhaltenden Unwohlseins und Schlafstörungen.
Diagnostik von Mundtrockenheit
Die Diagnose der Mundtrockenheit ist komplex und aufwändig. In vielen Studien wurde zunächst das subjektive Empfinden der Mundtrockenheit (Xerostomie) durch Fragebögen gemessen.41 Allerdings existieren in den methodischen Ansätzen erhebliche Unterschiede. Einige Studien konzentrieren sich lediglich auf das Vorhandensein oder Fehlen von Xerostomie,42 während andere die Häufigkeit dieser Empfindung untersuchen.43 Derartige Diskrepanzen führen zu Schwierigkeiten beim Vergleich der Ergebnisse verschiedener Untersuchungen und der Generierung eindeutiger, evidenzbasierter Diagnosekriterien. Um diese methodischen Herausforderungen zu überwinden, wurden neue Ansätze entwickelt, die strukturierte Skalen verwenden, um die subjektive Mundtrockenheit genauer zu quantifizieren. Ein Beispiel dafür ist das von Thomson et al. (1999) entwickelte Xerostomia Inventory (XI).44 Ein weiteres standardisiertes Instrument zur Diagnose der Xerostomie ist die visuelle Analogskala (VAS). Diese Methode ermöglicht es Patienten, ihren Grad an Mundtrockenheit selbst einzuschätzen, indem sie einen Punkt auf einer Skala zwischen "keine Mundtrockenheit" und "extreme Mundtrockenheit" markieren. Dadurch können (Zahn-)Ärzte das Ausmaß der Symptome und ihre Auswirkungen auf den Patienten besser verstehen und routinemäßig erheben.45
Daneben ist die sorgfältige orale Untersuchung von grundlegender Bedeutung, um klinische Anzeichen zu erkennen, die für eine Hyposalivation charakteristisch sind. Das Vorhandensein von diversen klinischen Anzeichen wurde von Osailan et al. beschrieben:46
- Anhaften des Mundspiegels an der Wangenschleimhaut oder der Zunge
- schaumiger Speichel
- keine Speichelansammlung im Mundboden
- Verlust der Papillen des Zungenrückens
- veränderte/glatte Gingivastruktur
- glasiges Aussehen der Mundschleimhaut (insbesondere des Gaumens)
- tief zerklüftete Zunge
- Zahnhalskaries (an mehr als zwei Zähne)
- Essensreste am Gaumen oder der Wangenschleimhaut (außer unter Zahnersatz)
- Halitosis
- Chelitis sicca bzw. Angular chelitis
- orale Candidiasis
- Glossodynie bzw. Glosspyrose37
Neben der klinischen Untersuchung und der Beobachtung von Symptomen ist es für die genaue Diagnose einer Hyposalivation unerlässlich, spezifischere Tests durchzuführen. Ein solcher Test ist die Sialometrie zur Messung der Speichelfließraten.
Hierbei wird zwischen der unstimulierten Speichelfließrate (USFR) und der stimulierten Speichelfließrate (SFR) unterschieden, wobei die USFR häufiger Verwendung findet. Die USFR misst die basale Speichelsekretion, während die SFR die Fähigkeit der Drüsen misst, ihre Sekretion in Reaktion auf einen Stimulus zu erhöhen. Sowohl die USFR als auch die SFR sollten vormittags und am besten auf nüchternen Magen oder frühestens zwei Stunden nach einer Mahlzeit durchgeführt werden.47
Der Patient sitzt dabei aufrecht auf dem Behandlungsstuhl. Die Messung der USFR beginnt in der Regel damit, dass der Patient aufgefordert wird, jeglichen vorhandenen Speichel zu schlucken, um einen Ausgangspunkt zu setzen. Anschließend wird der Patient gebeten, für einen definierten Zeitraum – in der Regel fünf Minuten – still zu sitzen, nicht zu sprechen, essen, trinken oder sonstige Bewegungen mit dem Mund auszuführen. Während dieses Zeitraums sammelt der Patient kontinuierlich Speichel im Mund und spuckt diesen in ein Gefäß oder lässt den Mund während der Messung offen und fängt sämtlichen Speichel auf (sog. Draining-Methode).48 Der gesammelte Speichel wird dann gemessen, um die Fließrate pro Minute zu bestimmen. Es gibt verschiedene Referenzbereiche für die USFR. Generell wird angenommen, dass eine USFR von 0,3 bis 0,4 ml/min im Normalbereich liegt. Eine USFR unter 0,2 ml/min weist auf eine Hypofunktion der Speicheldrüsen hin.
Die Messung der SFR folgt im Allgemeinen dem gleichen Protokoll wie die Messung der USFR, mit dem Unterschied, dass ein Stimulus – in der Regel eine saure Substanz oder eine Paraffinkugel – verwendet wird, um die Speicheldrüsen zu aktivieren.49 Nach dem Schlucken des vorhandenen Speichels wird der Patient gebeten, den Stimulus zu verwenden und zu kauen und anschließend den entstehenden Speichel für fünf Minuten in ein Gefäß zu spucken. Die Menge des gesammelten Speichels wird gemessen und die Fließrate pro Minute berechnet, um die SFR zu bestimmen. Die Referenzwerte für die SFR liegen im Allgemeinen zwischen 1,0 und 2,0 ml/min. Werte unter 0,7 ml/min können auf eine Hyposalivation hindeuten, manche Autoren sprechen als Referenzwerte von unter 0,5 ml/min.
Der Speichelfluss (sowohl stimuliert als auch unstimuliert) kann auch selektiv von einer Hauptspeicheldrüse oder einer Nebenspeicheldrüse gemessen werden. Das Sekret der Ohrspeicheldrüse wird in der Regel mit einer Absaugvorrichtung und einem Becher (Lashley- oder Carlson-Crittenden-Becher) über dem Ductus Stensen gesammelt.49 Dies ist jedoch sehr aufwendig und findet daher in der klinischen Praxis selten Anwendung.
Es ist wichtig zu betonen, dass die USFR und die SFR individuell stark variieren können und von mehreren Faktoren beeinflusst werden, darunter Alter, Geschlecht, Tageszeit, Medikamenteneinnahme und allgemeiner Gesundheitszustand.
Neben den beschriebenen Skalen und der Sialometrie sind auch neuere Methoden zur objektiven Diagnostik der unstimulierten Hyposalivation Teil aktueller klinischer Forschung des Autors. Der modifizierte Schirmer-Test (MST) könnte zukünftig ein nicht invasiver, einfacher und kosteneffizienter Test zur Beurteilung der Speichelfunktion sein.50 Ursprünglich für die Diagnose von Augentrockenheit entwickelt, wurde der Schirmer-Test modifiziert, um die Speichelsekretionsrate zu messen, insbesondere bei Patienten mit vermuteten Speicheldrüsenerkrankungen wie dem Sjögren-Syndrom. Ob und wie reliabel der Test funktionieren kann, ist Bestandteil aktueller Studien.
Mögliche Therapieoptionen
Die Behandlung von Mundtrockenheit erfordert eine individuell zugeschnittene Herangehensweise aufgrund der vielfältigen Ursachen, die zu diesem Zustand führen können. Interessanterweise beginnen viele Patienten erst dann über den Mangel an Speichel zu klagen, wenn ihre Speichelflussrate um mehr als die Hälfte reduziert ist. Aus diesem Grund sollten Praxisteams besonderen Wert auf die frühzeitige Identifizierung, insbesondere bei bestehenden Risikofaktoren, ausführliche Dokumentation und gründliche regelmäßige Untersuchung der individuellen Ursachen legen. Eine umfassende Aufklärung und Sensibilisierung sind ebenfalls unerlässlich.
Lebensstilanpassungen
Erster Schritt zur Milderung der Symptome ist die Modifikation des Lebensstils.51 Eine angemessene Hydratation, insbesondere durch Wasseraufnahme, spielt eine zentrale Rolle bei der Erhaltung der Mundfeuchtigkeit. Die Vermeidung von Tabak und Alkohol kann ebenfalls dazu beitragen, die Symptome zu minimieren, da beide Substanzen die Mundtrockenheit potenzieren können. Zudem kann eine ausgewogene Ernährung reich an Obst und Gemüse den Speichelfluss anregen. Schließlich unterstützen regelmäßige Mundhygienemaßnahmen wie das Zähneputzen mit fluoridierter Zahnpasta und die Verwendung von fluoridierten Mundspülungen die Reduktion des Kariesrisikos, das durch die verringerte Spül- und Pufferkapazität des Speichels begünstigt wird.
Zusätzliche präventive Maßnahmen
In Bezug auf die Zahnpflege ist der Einsatz von Produkten mit Calcium- und Phosphationen wie CPP-ACP oder Hydroxylapatit sinnvoll. Hydroxylapatit ist aufgrund seiner Ähnlichkeit mit dem natürlichen Zahnschmelz ein biomimetischer Wirkstoff. Najibfard et al. haben gezeigt, dass Hydroxylapatit auch bei geringem Speichelfluss wirksam ist.52 Von der alleinigen Anwendung von Hydroxylapatitprodukten statt Fluoriden muss aufgrund der deutlichen dokumentierten Überlegenheit von Fluoriden in Hinblick auf Kariesprävention abgeraten werden. Darüber hinaus sollten Produkte mit Wirkstoffen mit polaren funktionellen Gruppen wie Glycerin, Sorbitol oder Betain empfohlen werden, da diese Feuchtigkeit im Gewebe zurückhalten und für ein angenehmes Mundgefühl sorgen können. Neben der mechanischen Plaquekontrolle durch das Zähneputzen kann durch antimikrobielle Wirkstoffe wie Xylitol, Zink oder Lactoferrin eine zusätzliche Hemmung des Biofilmwachstums erreicht werden. Vor allem bei älteren Menschen kann eine Vielzahl von Fluoridierungsmaßnahmen empfohlen und praktisch umgesetzt werden, besonders wenn ein erhöhtes Kariesrisiko festgestellt wird. Diese Maßnahmen können neben den allgemeinen Plaquekontrollmaßnahmen eine signifikante Rolle bei der Prävention und nichtinvasiven Therapie von Wurzelkaries spielen.
Insbesondere können Fluoridlacke und F-CHX-Lacke als wirksame Alternativen in Betracht gezogen werden. Die Verwendung einer hochkonzentrierten 5.000 ppm Fluoridzahnpaste (Duraphat) zeigt ebenfalls eine hohe Effektivität sowohl in der Arretierung einer aktiven Wurzelkaries als auch in der Prävention neuer kariöser Läsionen.53
Eine andere wichtige Intervention wäre die Anwendung von Silberdiaminfluorid (SDF), welche eine starke Ablagerung von CaF2-ähnlichen Präzipitaten sowie die Bildung von silberphosphathaltigen Präzipitaten bewirkt. Zudem bietet es den Vorteil antibakterieller Silberionen, was zu einem starken therapeutischen Effekt führt.54
Speichelersatzmaterialien
Speichelersatzstoffe sind Materialien, die als Alternative oder Ergänzung zum natürlichen Speichel dienen. Sie zielen darauf ab, die Auswirkungen einer reduzierten Speichelproduktion zu minimieren, indem sie die feuchtigkeitsspendende, lubrizierende und puffernde Funktion von Speichel simulieren. Verschiedene Arten von Speichelersatzmaterialien einschließlich Gelen, Sprays, Tabletten und Mundspülungen sind auf dem Markt erhältlich und werden in Abhängigkeit von der spezifischen Symptomatologie des Patienten ausgewählt.
Die Wirksamkeit von Speichelersatzmaterialien hängt von ihrer Fähigkeit ab, eine physiologisch relevante Umgebung im Mund zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Ein idealer Speichelersatz sollte die gleichen wichtigen Eigenschaften wie natürlicher Speichel aufweisen, einschließlich einer geeigneten Viskosität und pH-Balance. Er sollte auch antimikrobielle Bestandteile enthalten, um das Risiko von Infektionen zu reduzieren, und Remineralisierungsmittel, um die Zahngesundheit zu fördern.
Die gängigen Speichelersatzmaterialien enthalten Substanzen wie Carboxymethylcellulose oder Hydroxyethylcellulose, die die lubrizierenden Eigenschaften von Speichel simulieren.55 Sie enthalten oft auch Stoffe wie Xylitol, das antimikrobielle Eigenschaften besitzt und die Kariesentwicklung verhindert.38, 51 Barbe et al. konnten zeigen, dass die Verwendung von GUM® HYDRAL (Sunstar) in der Lage ist, die Mundgesundheit und die mit Xerostomie verbundene Lebensqualität wirksam zu verbessern.56 GUM® HYDRAL soll die Mundschleimhaut vor einer durch Trockenheit bedingten Reizung schützen, indem sie eine schützende Barriere bildet. Durch den Einsatz von Polyvinylpyrrolidone (PVP), Natriumhyaluronat, Betain, Taurin und Propandiol soll eine Schutzschicht über die trockene Mundschleimhaut gelegt werden und ein mechanischer Schutz samt ausgiebiger Hydratation erreicht werden.
Darüber hinaus wurden metabolitbasierte Therapien entwickelt, um die Symptome der Xerostomie zu lindern. Dabei zeigten sowohl topisches sialagoges Spray mit 1 % Apfelsäure als wichtigem Stoffwechselintermediär als auch Retinsäure, der aktive Metabolit von Vitamin A (fördert Wachstum und die Differenzierung von Epithelstammzellen), und Coenzym Q10, ein wichtiges Enzym der Atmungskette, positive Auswirkungen.57,58 Zusätzlich kann die Supplementierung mit Ubiquinol die Speichelflussrate sowohl bei Kurzzeit- als auch bei Langzeitbehandlung erhöhen.58 In-vitro-Experimente zeigten, dass Ubiquinol die ATP-Produktion stimulieren und oxidativen Stress in Speicheldrüsenzellen unterdrücken kann, was zur Verbesserung der Speichelflussrate beitragen könnte.58
Medikamentöse Therapie
In Situationen, in denen Mundtrockenheit aufgrund der Einnahme bestimmter Medikamente auftritt, kann eine Anpassung der Medikation in Absprache mit dem behandelnden Hausarzt hilfreich sein,38 vor allem bei Medikamenten, die eine hohe anticholinerge Potenz haben. Durch einen Medikamentenwechsel kann diese anticholinerge Belastung so weit gesenkt werden, dass die induzierten Nebenwirkungen deutlich reduziert werden.
Sollte eine Änderung der Medikamenteneinnahme nicht möglich sein, existieren Medikamente, die als Speichelanreger fungieren. Sialagoga, darunter die prominenten Beispiele Pilocarpin und Cevimelin, ahmen neuronale Signale nach, um die Speichelproduktion und -sekretion zu stimulieren, da diese durch Neurotransmitter gesteuert werden.59–62 Das Hauptziel von Pilocarpin ist der Muscarinrezeptor 1 (M1), während das Hauptziel von Cevimelin der Muscarinrezeptor 3 (M3) ist.51 Die empfohlene Dosierung von Cevimelin beträgt üblicherweise 30 mg oral dreimal täglich. Die maximale Tagesdosis sollte 90 mg nicht überschreiten.
Pilocarpin als das am häufigsten genutzte parasympathomimetische Medikament mit den besten Ergebnissen, vorausgesetzt es besteht eine gewisse Restfunktion des Parenchyms.63 Die übliche Anfangsdosis beträgt 5 mg oral drei- bis viermal täglich. Diese Dosis kann nach ärztlicher Anweisung auf bis zu 10 mg pro Anwendung erhöht werden. Studien wurden unter Verwendung unterschiedlicher Dosen (3 und 5 mg), mit unterschiedlichen Applikationsmethoden (Schlucktabletten, Auflösen von Tabletten im Mund oder Spüllösung) durchgeführt. Eine lokalisierte Behandlung mit Pilocarpin durch das Auflösen von Tabletten oder Spülungen mit 0,1 % scheint effektiver zu sein als eine systemische Verabreichung. Beide Medikamente sind wirksam in der Stimulierung der Speichelproduktion, obwohl individuelle Reaktionen auf die Therapie variieren können. Allerdings können diese Medikamente aufgrund ihrer Wirkungsweise und der ubiquitären Expression der Muscarinrezeptoren im Körper, welche ihre Zielmoleküle darstellen, zu ernsthaften Nebenwirkungen (häufiges Wasserlassen, Schwindel und Schwitzen, Übelkeit, Durchfall, Vasodilatation, Bronchokonstriktion, Hypotonie und Bradykardie) führen und mit existierenden Krankheiten (Asthma, chronischen Lungenerkrankungen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen) interagieren.38, 64, 65 Patienten, die Cevimelin einnehmen, können aufgrund der spezifischen Zielsetzung auf M3-Muskarinrezeptoren weniger Nebenwirkungen im Vergleich zu Pilocarpin erfahren.
Interdisziplinäres Zusammenspiel
In der komplexen Behandlung der Mundtrockenheit nimmt die Interaktion zwischen Zahnmedizinern und anderen medizinischen Experten eine entscheidende Position ein. Die Heterogenität der Erkrankung macht ein vielschichtiges medizinisches Verständnis notwendig, in dem der Zahnarzt oftmals die koordinierende Kerntätigkeit nach entsprechender Diagnostik übernimmt. Indes sind auch andere Fachkräfte, darunter Allgemeinmediziner, Pharmazeuten, Ernährungsexperten und die Fachpflegekräfte mit Fokus auf spezifischen Krankheiten wie Diabetes oder neurologischen Störungen, im Prozess der Patientenversorgung essenziell involviert. Eine solche interprofessionelle Kollaboration führt zur Präzisierung von Diagnosen, maßgeschneiderten Behandlungsplänen und der frühzeitigen Erkennung und Therapie potenzieller Komplikationen.66
Neueste Untersuchungen betonen die Relevanz der interdisziplinären Zusammenarbeit in der Behandlung. Die Forschung zeigt, dass ein interprofessioneller Ansatz zu einer höheren Patientenzufriedenheit führt, die Symptome effizienter lindert und das allgemeine Wohlbefinden der Patienten verbessert.67 Gegenwärtig wird auch an Modellen zur Verbesserung der Kommunikation und Koordination zwischen den verschiedenen Gesundheitsdienstleistern gearbeitet, um die Versorgungsqualität weiter zu steigern. Dabei gewinnt die Bildung von Partnerschaften und Netzwerken zwischen unterschiedlichen Gesundheitsdienstleistern als zentrale Strategie zur Optimierung der Versorgung von Patienten mit Mundtrockenheit an Bedeutung.68
Fazit
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Mundtrockenheit ein weitverbreitetes medizinisches Phänomen mit einer hohen Prävalenz, insbesondere im höheren Lebensalter, ist, dessen Ausmaß und Auswirkungen oftmals unterschätzt werden. Diese Zustände können durch verschiedene Faktoren wie Alter, Medikamenteneinnahme und systemische Erkrankungen wie Diabetes und Parkinson hervorgerufen werden. Sie haben erhebliche Auswirkungen auf das tägliche Leben und die Lebensqualität der Betroffenen, da der Speichel nicht nur der Befeuchtung der Mundhöhle dient, sondern viele essenzielle Funktionen für das Sprechen, Schlucken und Schmecken erfüllt und dabei hilft, das Risiko für Karies und andere orale Erkrankungen zu verringern. Als Diagnosetools stehen Fragebögen zur Erfassung der Xerostomie und die Sialometrie zur Bestimmung der Speichelfließraten zur Verfügung. Die Therapie ist nach wie vor anspruchsvoll und komplex. Mittlerweile können gute Ergebnisse mit der Änderung des Lebensstils, der Anpassung der Medikation und durch den Einsatz von Speichelersatzmaterialien erzielt werden. Beim Einsatz von Produkten sollten Wirkstoffe wie Natrium-Hyaluronat, Betain, Taurin und Natriumzitrat enthalten sein (wie z. B. GUM® HYDRAL). Dennoch erfordern die Herausforderungen bei Diagnose und Behandlung der Mundtrockenheit eine kooperative, interdisziplinäre Strategie zwischen Zahnärzten und den anderen medizinischen Fachdisziplinen.
Eine Literaturliste steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung.