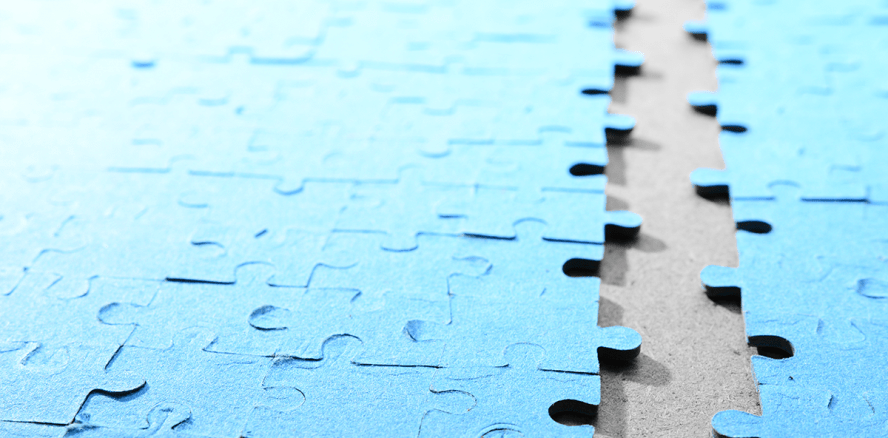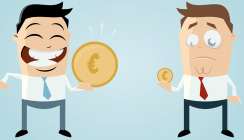Recht 07.07.2017
Selbstständig oder angestellt in der Praxis: Wo verläuft die Grenze?
share
Beim Einsatz externer Dienstleister in der Praxis ist ein besonderes Augenmerk gefragt. Ob jemand abhängig beschäftigt oder selbstständig tätig ist, hängt im Ergebnis davon ab, welche Merkmale überwiegen. Bei Zweifeln sollte rechtlicher Rat eingeholt werden.
Das Landessozialgericht Baden-Württemberg (LSG) hat sich in einer kürzlich veröffentlichten Entscheidung (Az.: L 4 R 4979/15) mit der Frage befasst, wann eine selbstständig in Zahnarztpraxen tätige Zahnmedizinische Verwaltungsassistentin doch als sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmerin einzustufen ist.
Viele Praxen bedienen sich bei der Abrechnung und Verwaltung freier Mitarbeiter. Im Falle einer Betriebsprüfung werden diese häufig von der Deutschen Rentenversicherung auf den Prüfstand gestellt. Deswegen kommt es immer öfter auch in gerichtlichen Entscheidungen zur Abgrenzung einer selbstständigen von einer angestellten Tätigkeit.
Der Sachverhalt
Im vorliegenden Streitfall hatte eine niedergelassene Zahnärztin eine geprüfte Zahnmedizinische Verwaltungsassistentin zur Erstellung von Kostenplänen, Abrechnungen, Kontrollarbeiten sowie zur Rechnungstellung an Patienten eingesetzt. Die Zahnmedizinische Verwaltungsassistentin hatte an ihrem Wohnsitz ein entsprechendes Gewerbe angemeldet und ein Büro eingerichtet. Sie übernahm Praxisverwaltungstätigkeiten für sechs Zahnarztpraxen. Zur Ausübung dieser Tätigkeit verfügte sie über ein Auto, einen Laptop, ein Mobiltelefon und eigenes Briefpapier. Sie war aufgrund eines mündlich geschlossenen Vertrages für die klagende Zahnärztin tätig und stellte der Zahnärztin ihre Tätigkeit jeweils monatlich aufgeschlüsselt nach geleisteten Zeitstunden in Rechnung.
Die Zahnmedizinische Verwaltungsassistentin beantragte bei der Deutschen Rentenversicherung die Feststellung ihres sozialversicherungsrechtlichen Status dahingehend, dass keine Beschäftigung in der Praxis der Zahnärztin vorliege. Hierzu führte sie aus, dass sie nicht in der Praxis angestellt, sondern selbstständig und ohne An- weisungen ihre Tätigkeiten verrichte.
Sie könne sich ihre Zeit sowohl innerhalb als auch außerhalb der Praxissprechzeiten frei einteilen. Sie sei in der Mittagspausenregelung frei, Urlaub und Krankheitsausfall würden nicht bezahlt. Es bestünden keine längerfristigen Verträge mit der Praxisinhaberin, der Auftrag könne quasi von heute auf morgen beendet werden. Tätigkeitsort sei in der Regel die Praxis des Auftraggebers. Sie nehme jedoch an Teambesprechungen nicht teil und erhalte auch keine Weisungen der Zahnärztin. Die Deutsche Rentenversicherung stufte die Verwaltungsassistentin dennoch als abhängige Beschäftigte der Zahnarztpraxis ein, mit der Folge einer Versicherungspflicht in der Rentenversicherung sowie nach dem Recht der Arbeitsförderung. Bei Gesamtwürdigung aller zu beurteilenden Tatsachen überwö-gen die Merkmale für ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis. Dies ergebe sich insbesondere daraus, dass die Tätigkeit in der Praxis der Zahnärztin ausgeübt werde. Durch diese werde ein Arbeitsplatz gestellt, für welchen keine Kostenbeteiligung zu übernehmen sei. Zur Auftragsausführung benötigte Betriebsmittel (Patientendaten, Praxisabrechnungsprogramm, Kostenpläne) würden durch die Zahnärztin gestellt. Nach Beendigung der Arbeitszeit erfolge zudem eine Abmeldung bei der Zahnärztin und es bestehe eine persönliche Leistungspflicht. Durch Übernahme der administrativen Aufgaben der Praxis erfolge explizit eine Eingliederung in den Betriebsablauf.
Gegen diese Einstufung der Zahnmedizinischen Verwaltungsassistentin als abhängig Beschäftigte setzte sich die Zahnärztin erfolgreich vor Gericht zur Wehr.
Die Entscheidung
Das LSG entschied – wie auch schon das erstinstanzliche Sozialgericht –, dass Anhaltspunkte für eine Beschäftigung nach Weisungen und eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers hier gerade nicht zu erkennen gewesen seien. Im vorliegenden Fall habe die Zahnmedizinische Verwaltungsassistentin keinem Weisungsrecht der Zahnärztin in arbeitsrechtlicher und örtlicher Hinsicht unterlegen, sie sei frei in der Wahl der Arbeitszeiten gewesen und es habe keine Zusammenarbeit mit den übrigen Angestellten der Zahnärztin gegeben. Zudem habe die Zahnmedizinische Verwaltungsassistentin ein Stundenhonorar für die tatsächlich erbrachten Leistungen erhalten und kein Mindesteinkommen, keinen bezahlten Urlaub und auch keine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfalle. Letztlich habe sie über die Tätigkeit für die klagende Zahnärztin hinaus noch für fünf weitere Zahnarztpraxen Dienstleistungen erbracht.
Dies spreche für eine Selbstständigkeit. Dieser Annahme einer selbstständigen Tätigkeit stehe nach Auffassung des LSG auch nicht entgegen, dass die Zahnmedizinische Verwaltungsassistentin ihre Tätigkeit überwiegend in der Praxis der Zahnärztin ausgeübt und hierfür die vorhandene Hard- und Software der Praxis genutzt habe. Auch dass vorliegend kein Einsatz eigenen Kapitals bzw. eigener Betriebsmittel erfolgt sei, spreche nicht automatisch gegen eine Selbstständigkeit. Ob jemand abhängig beschäftigt oder selbstständig tätig sei, hänge im Ergebnis davon ab, welche Merkmale überwiegen. Dies spreche hier in der Gesamtschau für eine selbstständige Tätigkeit.
Fazit
Dennoch ist beim Einsatz externer Dienstleister in der Praxis ein besonderes Augenmerk gefragt. Eine andere Entscheidung des LSG Berlin-Brandenburg (Az.: L 1 KR 118/14) verdeutlicht, dass der Grad zwischen selbstständiger und abhängiger Tätigkeit schmal sein kann. Das LSG Berlin-Brandenburg kam anders als im vorliegenden Fall zu der Einschätzung, dass die Tätigkeit einer selbstständigen Abrechnungsspezialistin eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung darstelle, da sie in der Zahnarztpraxis und unter Verwendung der dortigen Hard- und Software arbeitete, die Rechnungen, Mahnungen und Abrechnungen anders als eine Abrechnungsstelle nicht in eigenem Namen erstellt hat und ihre Arbeitsergebnisse sich für die Praxisinhaberinnen lediglich als Entwürfe darstellten. Zudem ergaben sich hinsichtlich der Arbeitszeiten Einschränkungen aufgrund der Praxiszeiten. Auch der Einsatz eigener Arbeitsmittel war nicht erforderlich gewesen und es wurde eine erfolgsunabhängige Stundenvergütung gezahlt, sodass kein Unternehmerrisiko erkennbar war. Hier bejahte das LSG Berlin-Brandenburg somit im Ergebnis eine abhängige Tätigkeit.
Daher ist im Einzelfall genau zu prüfen, ob die Kriterien für eine selbstständige Tätigkeit erfüllt sind oder aber eine abhängige Beschäftigung vorliegt. Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts liegt eine solche Beschäftigung vor, wenn die Tätigkeit in persönlicher Abhängigkeit erbracht wird. Dieses Merkmal ist bei einer Beschäftigung in einem fremden Betrieb gegeben, wenn der Beschäftigte in den Betrieb eingegliedert ist und mit seiner Tätigkeit einem mit Zeit, Dauer, Ort und Art der Ausführung erfassenden Weisungsrecht unterliegt. Dagegen ist eine selbstständige Tätigkeit durch ein eigenes Unternehmerrisiko, das Vorhandensein einer eigenen Betriebsstätte, die Verfügungsmöglichkeit über die eigene Arbeitskraft und die im Wesentlichen freie Gestaltung von Tätigkeit und Arbeitszeit gekennzeichnet.
Die grundlegenden Abgrenzungskriterien sind daher die des Vorliegens eines Unternehmerrisikos, der mangelnden Weisungsgebundenheit und der fehlenden Eingliederung in das Unternehmen. Ob eine abhängige Beschäftigung oder selbstständige Tätigkeit vorliegt, ist daher stets im jeweiligen Einzelfall zu beurteilen. Bei Zweifeln sollte rechtlicher Rat eingeholt werden, da im Falle einer Scheinselbstständigkeit dem Praxisinhaber sowohl Nachzahlungen und Bußgelder für entgangene Sozialversicherungsbeiträge als auch das Risiko einer strafrechtlichen Verfolgung drohen.
Der Artikel ist in der ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis 5/2017 erschienen.