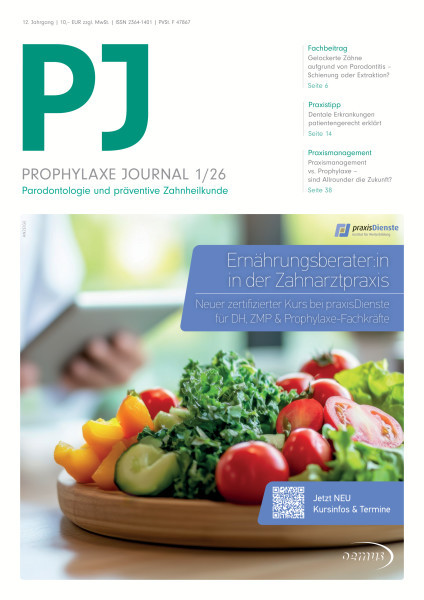Praxismanagement 30.10.2025
Ich und Veränderung?! Vom Mut, als Führungskraft Veränderungen anzustoßen
share
Zeit für den Abschied nehmen
Es beginnt mit der Trauerarbeit, um sich von dem bisher Vertrauten zu lösen. Mitunter brauchen Menschen sehr lange, um sich von den bisherigen Ritualen zu verabschieden. Bei dem Verlust eines Menschen dauert ein Trauerprozess mindestens ein Jahr bzw. eine „Runde“ der Familienrituale (1 x Ostern, Geburtstag, Weihnachten etc.). Die erste Runde ist meist besonders schmerzhaft. Während den ersten Zusammentreffen ohne diesen Menschen entstehen neue Erfahrungen. Von Jahr zu Jahr nimmt das Erfahrungspolster zu, auf das man zurückgreifen kann.
Die Trauerarbeit bei persönlichen Verletzungen (z. B. im Team) dauern erfahrungsgemäß ähnlich lange. Meist wagen Betroffene den Schritt zu Veränderungen erst dann, wenn die eigenen Verletzungen einen bestimmten Grad an Intensität erreicht haben. Umstehende Personen allerdings (Kolleg/-innen, Mitarbeiter/-innen, Chef/-innen) haben diese Konflikte schon viel früher erkannt, wahrgenommen und darunter gelitten. Vielleicht haben sie zu Beginn auch etwas gesagt – und irgendwann dann geschwiegen. Oder sie verlassen das Unternehmen. Gerade Mitarbeiter/-innen trauen sich selten oder gar nicht, die Führungskräfte offen zu kritisieren. Schließlich sind sie abhängig von den Arbeitgebern. Das Schweigen in solchen Konflikten ist besonders gefährlich für alle Beteiligten: Wer selbst Teil des Konflikts ist, nimmt vor allem die eigenen Gefühle und Handlungen wahr. Wenn das Umfeld schweigt, wertet man dieses Schweigen häufig als Zustimmung – und fühlt sich dadurch in der eigenen Sichtweise bestätigt („Die Schuld liegt bei XY“). Dabei signalisiert das Schweigen der Anderen einfach deren Resignation. Man nennt solche Konflikte kalte Konflikte. Sie sind schwer lösbar und die Veränderung hin zu einem harmonischen Miteinander dauert Monate.
Sich selbst die Zeit für den Abschied schenken – in diesem Fall bedeutet es vor allem, sich mit den Emotionen auseinanderzusetzen, die bei einem offenen Umgang mit Konflikten ausgelöst werden.
Bereitschaft, die eigene Wahrnehmung infrage zu stellen
Das selbst Wahrgenommene infrage stellen? Das ist vielleicht der schwierigste Part von allen. Gerade in Konflikten oder Stressmomenten wird das eigene Weltbild zunehmend zum Maßstab der Umwelt. Wie man denkt und handelt ist allein richtig. Handlungsweisen anderer, die diesem Weltbild nicht entsprechen, werden zunehmend ignoriert. Positive Eigenschaften des anderen nimmt man in der Folge weniger wahr. All das ist menschlich nachvollziehbar, denn die Verletzungen sitzen tief. So leugnet man gerne das Positive des anderen im Alltag. Das passiert unbewusst – ein typischer Verlauf bei Konflikten. Da der Konfliktpartner ebenso handelt, entsteht eine Spirale von Leugnen, Vorwürfen und gegenseitigen Verletzungen. Auch wenn es unbewusste Tendenzen sind, müssen sie durchbrochen werden, um eine neue Weltsicht zu erlangen.
Widerstand bei sich und anderen akzeptieren
Bei allen Veränderungen – egal aus welchen Anlässen – trifft man immer auf Widerstände bei denjenigen, die davon betroffen sind. Bei sich selbst („Soll sich doch die/der Andere ändern, mich betrifft es nicht“) oder bei den Anderen („Die da oben denken sich Dinge aus, die man eh nicht umsetzen kann“). Das hat viel mit der Trauerarbeit zu tun, die wir schon kennengelernt haben. Menschen nehmen Veränderungen als Bedrohung wahr, wenn ihnen keine Zeit zum Abschied bleibt und sie nicht wissen, wie es weitergehen soll. Weil ihnen Ziele und Erfahrungswerte fehlen oder sie in der Konfliktspirale verhaftet sind. Wer in dem Muster von Schuld und Vorwürfen denkt, empfindet eine Veränderung nur dann als positiv, wenn sie das eigene Weltbild bestärkt. Spüren Sie bei sich Widerstände, so gehen Sie bitte offen damit um. Hilfreich sind zunächst Fragen wie:
- Wovor habe ich gerade Angst? Was macht mich wütend?
- Was ist mein Beitrag bei diesem Konflikt?
- Welche Gefühle spüre ich gerade?
- Was brauche ich, um damit leben zu können? (Nicht, was der Andere für Sie tun kann, denn für Ihre Emotionen tragen Sie allein die Verantwortung.)
- Habe ich früher schon einmal eine solche Situation erlebt? Wie bin ich damit umgegangen? Was hat mich damals erfolgreich gemacht?
Dann kommt der nächste Schritt:
- Was braucht die/der andere von mir?
- Was ist positiv an ihrem/seinem Verhalten?
- Was schätze ich an ihr/ihm?
Widerstände bei Mitarbeiter/-innen oder dem ganzen Team sind völlig normal, wenn Veränderungen anstehen. Meist sind es Themen, die für die Chef/-innen banal erscheinen, die aber bei den Betroffenen große Widerstände hervorrufen. Oft sind die Chefs schon bei der übernächsten Veränderung, aber die Mitarbeiter selbst sind noch mit dem vorletzten Projekt beschäftigt. Wir haben gelernt, woran es liegt: Es ist das Abschiednehmen. Sagt dann ein/-e Mitarbeiter/-in einen Satz wie: „War denn früher alles schlecht, was ich gemacht habe?“, dann trifft das den Nagel auf den Kopf. Die bisher geleistete Arbeit möchte man gewürdigt wissen. Hier helfen Einzelgespräche und Teambesprechungen, in denen die Ziele der Veränderung besprochen und erste Erfolge aus dem Team berichtet werden können.
Wichtig bei Beginn einer Veränderung ist die Erkenntnis, dass Widerstände zu Veränderungen dazugehören. Die eigenen Widerstände sind gute Indikatoren für eigene Emotionen.
Positiv auf das Vergangene blicken und offen für die Zukunft werden
Es ist wichtig, mit der Vergangenheit positiv abzuschließen, um eine neue Sicht für die Zukunft zu ermöglichen. Ist unser Gehirn im Vorwurf-Problemmodus, denken wir rückwärtsgewandt. Wir sehen die eigenen Verletzungen und uns damit als Opfer – die anderen sind die Täter. Die eigene Wahrnehmung ist Richtschnur, uns fremde Weltbilder werden per se abgewertet.
All das verhindert eine Veränderung im positiven Sinne und eine gemeinsame Lösung. Aber um diese Lösung geht es und nicht um Schuldige. Weil Veränderung bedeutet, das Vergangene abzuschließen und dann offen für eine unbekannte Zukunft zu werden. Apropos Zukunft: Der geschilderte Weg der Veränderungen verlangt viel von den Betroffenen. Das ist klar. Natürlich können Sie auch einen anderen Weg wählen: die Firma, die Praxis verlassen und sich eine neue Arbeitsstelle suchen. Damit würden Sie sich allerdings eine große Chance nehmen: die Chance auf Veränderung bei sich selbst. Sie würden zwar die Umstände, aber nicht Ihr Denk-/Verhaltensmuster ändern. Die Möglichkeit, Praxis oder Team zu verlassen, besteht immer. Der entscheidende Unterschied ist jedoch Ihre innere Haltung: Gehen Sie aus der Praxis, weil die anderen Schuld sind? Weil die anderen sich nicht ändern wollten? Dann nehmen Sie genau diese Haltung auch mit in Ihr neues Arbeitsverhältnis. Das Verhältnis zum jetzigen Team/Chef wird entsprechend angespannt bleiben. Und Sie selbst gehen, weil Sie das Gefühl haben, gehen zu müssen. Im neuen Job nehmen Sie dann allerdings diese Denk-/Verhaltensmuster mit und die Wahrscheinlichkeit, dass ein ähnlicher Konflikt mit anderen Menschen entsteht, ist sehr wahrscheinlich. Die Alternative dazu ist eine Auseinandersetzung mit sich selbst, mit den eigenen Wahrnehmungsmustern und Gefühlen. Ich gebe zu, das ist nicht einfach. Aber es macht Sie um einiges stärker. Wenn Sie dennoch das Arbeitsumfeld verlassen, dann tun Sie es, weil Sie es wollen. Weil Sie ein Ziel haben und nicht flüchten müssen, denn Sie lassen Freund/-innen und Kolleg/-innen zurück. Sie gehen nicht im Streit, denn dieser ist beigelegt.
Diese Erfahrung macht stark. Sie verändert uns nachhaltig, weil wir eine andere Wahrnehmung der Umwelt entwickeln. Wir fangen an, in Lösungen zu denken, die Bedürfnisse der anderen wahrzunehmen und mit den eigenen in Einklang zu bringen. Es ist die Fähigkeit zur Resilienz, die wir hierbei entwickeln können. Es ist die Fähigkeit, mit Schicksalsschlägen oder schwierigen Situationen umgehen zu können, indem man diese aushält und es keine weiteren Beeinträchtigungen gibt.