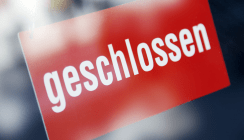Recht 09.11.2016
Angestellte Zahnärzte – Wann ist ein Gehalt unangemessen?
share
In § 8 Abs. 3 der Musterberufsordnung der Bundeszahnärztekammer ist normiert: "Der Zahnarzt hat angestellten Zahnärzten eine angemessene Vergütung zu gewähren." Es stellt sich hier die Frage, was eine "angemessene Vergütung" und eine "nicht angemessene Vergütung ist". Das Bundesarbeitsgericht (BAG) und der Bundesgerichtshof haben hier zwei Entscheidungen getroffen, die für die Einordnung einer angemessenen Vergütung - auch bei Ärzten und Zahnärzten - sehr hilfreich sind.
Die Vereinbarung einer Vorbereitungszeit z.B. als "Praktikum" und unter Mindestlohn ist selbstverständlich unzulässig und zudem auch hoch problematisch. Arbeitgeber, die sich nicht an das Mindestlohngesetz halten, müssen mit hohen Sanktionen (u.a. Geldbuße bis 500.000 Euro, Nachforderungsansprüche der Sozialversicherungsträger) rechnen. Bei Ärzten und Zahnärzten, die ein langjähriges Studium absolviert haben, wird man aber - auch bei Berufsanfängern wie Vorbereitungsassistenten - nicht ohne weiteres davon ausgehen können, dass ein "Mindestlohn" angemessen im Sinne der in den Berufsordnungen verankerten "angemessenen Vergütung" ist. Hilfreich ist es zur Einordnung, sich mit der Rechtsprechung zu befassen, die sich mit der angemessenen Vergütung von Rechtsanwälten befasst hat.
BAG zur angemessenen Vergütung und Lohnuntergrenze
In seinem Urteil vom 17.12.2014 (5 AZR 663/13) hat sich das Bundesarbeitsgericht (BAG) mit der "Lohnuntergrenze" angestellter Rechtsanwälte befasst. Ein Rechtsanwalt hatte ein "befriedigendes" und ein "ausreichendes" Staatsexamen abgelegt, wobei über sehr gute Fremdsprachenkenntnisse verfügte. Als Angestellter Rechtsanwaltskanzlei erhielt er für eine Teilzeitbeschäftigung (20 Stunden wöchentlich) 1.200,00 Euro brutto im Monat, wobei er geltend machte, dass er die Vergütung für sittenwidrig erachtete.
Auffälliges Missverhältnis - Zwei-Drittel-Grenze
Nach Auffassung des BAG liegt ein auffälliges Missverhältnis zwischen dem Wert der Arbeitsleistung und der Vergütungshöhe vor, wenn die Arbeitsvergütung nicht einmal zwei Drittel der üblicherweise gezahlten Vergütung erreiche. Ein Anlass, von dieser Richtgröße im Sinne einer Heraufsetzung der Zwei-Drittel-Grenze abzuweichen, bestünde weder wegen der Besonderheiten in der Beschäftigung angestellter Rechtsanwälte noch der in § 26 der Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA) enthaltenen Vorgabe, Rechtsanwälte nur zu angemessenen Bedingungen zu beschäftigen.
Verstoße eine Entgeltabrede gegen § 138 BGB, schulde der Arbeitgeber gemäß § 612 Abs. 2 BGB die übliche Vergütung. Nach § 138 Abs. 2 BGB sei ein Rechtsgeschäft nichtig, durch das sich jemand unter Ausbeutung der Zwangslage, der Unerfahrenheit oder des Mangels an Urteilsvermögen eines anderen für eine Leistung Vermögensvorteile versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung stehen. Ein wucherähnliches Geschäft iSd. § 138 Abs. 1 BGB liege vor, wenn Leistung und Gegenleistung in einem auffälligen Missverhältnis zueinander stehen und weitere sittenwidrige Umstände wie z.B. eine verwerfliche Gesinnung des durch den Vertrag objektiv Begünstigten hinzutreten.
Auffälliges Missverhältnis - Arbeit zur Vergütungshöhe
Ob ein auffälliges Missverhältnis zwischen dem Wert der Arbeitsleistung und der Vergütungshöhe vorliege, bestimme sich nach dem objektiven Wert der Leistung des Arbeitnehmers. Das Missverhältnis sei auffällig, wenn die Arbeitsvergütung nicht einmal zwei Drittel der in dem betreffenden Wirtschaftszweig üblicherweise gezahlten Vergütung erreiche (BAG 22. April 2009 - 5 AZR 436/08). Ein Anlass, von dieser Richtgröße wegen der Besonderheiten in der Beschäftigung angestellter Rechtsanwälte abzuweichen, bestünde nicht.
Entscheidend für die Bestimmung eines auffälligen Missverhältnisses sei der Vergleich zwischen dem objektiven Wert der Arbeitsleistung und der "faktischen" Höhe der Vergütung, die sich aus dem Verhältnis von geschuldeter Arbeitszeit und versprochener Vergütung für eine bestimmte Abrechnungsperiode ergebe.
Vergütungshöhe - auch regionale Unterschiede beachtlich
Für die Ermittlung des Wertes der Arbeitsleistung sei nicht nur von Bedeutung, welchem Wirtschaftszweig das Unternehmen des Arbeitgebers zuzuordnen sei, sondern auch in welcher Wirtschaftsregion die Tätigkeit ausgeübt wird. Zudem werde das Entgelt angestellter Rechtsanwälte von personen- und marktbezogenen Determinanten beeinflusst. Zwischen der Höhe des Einkommens angestellter Rechtsanwälte und der Ortsgröße des Standorts der Kanzlei, in der sie tätig sind, bestünde ein Zusammenhang. Dies führe zu einer auf den einzelnen OLG-Bezirk abstellenden Betrachtung, in die weitere örtliche Besonderheiten einzubeziehen sein können, wenn dieser Bezirk größere strukturelle Unterschiede aufweise (vor allem Stadt/Land-Gefälle).
Fakten sind beizubringen
Zu diesen Vergleichsgrößen habe der Rechtsanwalt keinen hinreichend konkreten Sachvortrag geleistet. Seine Idee, das Gericht habe anhand seiner persönlichen Merkmale von Amts wegen das übliche Entgelt ggf. unter Einschaltung eines Sachverständigen zu ermitteln, sei mit dem das arbeitsgerichtliche Urteilsverfahren beherrschenden Beibringungsgrundsatz nicht zu vereinbaren.
Auch eine Studie des Instituts für Freie Berufe Nürnberg erlaube keine Schlüsse auf die am Beschäftigungsort des Rechtsanwaltes übliche Vergütung. Immerhin gelange diese Studie zu der Feststellung, Rechtsanwälte verdienten - unabhängig von ihrer beruflichen Stellung und dem betrachteten Jahr - mehr, je länger sie beruflich tätig seien. Die Studie ermittelte bezogen auf das Jahr 2006 als durchschnittliches Einkommen von in Sozietäten angestellten Rechtsanwälten in den alten und neuen Bundesländern bei einer anwaltlichen Tätigkeit von höchstens drei Jahren 38.000,00 Euro brutto, bei einer solchen von vier bis zehn Jahren von 55.000,00 Euro. Besonders wichtig seien die ausgesprochen vagen Aussagen der Studie zur aufgewendeten Wochenarbeitszeit. Sie würden mit "mindestens 40 Stunden" angegeben. Im Ergebnis konnte der Rechtsanwalt die von ihm angeführte Sittenwidrigkeit der Vergütung nicht belegen.
BGH-Beschluss zur angemessenen Vergütung
In einem Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 30.11.2009 (AnwZ (B) 11/08), wird bekräftigt, dass Rechtsanwälte nur zu angemessenen Bedingungen beschäftigt werden dürfen. Kanzleien, die Berufsanfänger eine unangemessen geringe Vergütung gewähren, würden gegen Ihre Berufspflichten verstoßen.
Traineestelle für einen Anwalt
Im konkreten Fall hatte eine Kanzlei eine "Traineestelle für junge Anwältinnen/Anwälte" ausgeschrieben. Die Anzeige enthielt u.a. folgenden Text:
"Der Trainee wird in ein auf zwei Jahre befristetes Angestelltenverhältnis inklusive sämtlicher Sozialversicherungen übernommen. Wir übernehmen zusätzlich die Kosten für die Berufshaftpflicht und die Anwaltskammer. Daneben übernehmen wir noch anfallende Fahrtkosten, die aus dienstlichem Anlass erfolgen. Wir unterstützen den jungen Anwalt auch bei Fortbildungsveranstaltungen durch Übernahme der Seminargebühren. Wir zahlen als Grundvergütung ein Gehalt, welches ein wenig über dem Referendargehalt liegt. Zusätzlich wird eine Umsatzbeteiligung an denjenigen Mandaten gewährt, die der Trainee selbst akquiriert".
Der BGH schloss sich in dem Beschluss der Auffassung der zuständigen Rechtsanwaltskammer an, wonach ein Gehalt um 1.000 Euro brutto monatlich, unangemessen niedrig sei und gegen die guten Sitten (§ 138 BGB) verstoße. Die angebotene Vergütung stünde hier in einem auffälligen Missverhältnis zu der geforderten Gegenleistung.
Sittenwidrigkeit bejaht
Selbst bei Bewertung der zusätzlich in Aussicht gestellten Leistungen (wie der Übernahme der Berufshaftpflichtversicherung, des Beitrags für die Anwaltskammer, der Seminargebühren für Fortbildungsveranstaltungen und möglicherweise des Arbeitnehmeranteils der Sozialversicherungsbeiträge) als Gehaltsbestandteile werde der Leser der Stellenanzeige nicht annehmen, dass der Wert der in Aussicht gestellten Leistungen mehr als 1250 Euro betrage. Die in Aussicht gestellte Umsatzbeteiligung an eigenen Mandaten sei nicht als Gehaltsbestandteil zu berücksichtigen, weil sich einem Berufsanfänger erfahrungsgemäß kaum die Möglichkeit zu erfolgreicher Akquisitionstätigkeit biete, so dass mit einem regelmäßigen über die Grundvergütung hinausgehenden Verdienst aus der Umsatzbeteiligung nicht zu rechnen sei.
Der Gesamtwert der in Aussicht gestellten Leistungen sei zu der verkehrsüblichen Vergütung von Rechtsanwälten in vergleichbaren Angestelltenverhältnissen in Beziehung zu setzen. Sie bestimme sich, wenn - wie hier - ein Tarifvertrag nicht existierte oder der vereinbarte Tariflohn nicht der verkehrsüblichen Vergütung entspreche, nach dem allgemeinen Lohnniveau in dem betreffenden Wirtschaftsgebiet.
Auffälliges Missverhältnis
Der Gesamtwert der in der Stellenanzeige in Aussicht gestellten Leistungen stehe zu dem branchenüblichen Einstiegsgehalt in einem auffälligen Missverhältnis i.S. von § 138 BGB. Nach der neueren Rechtsprechung des BAG (BAG, NZA 2009, 837) sei ein auffälliges Missverhältnis zwischen der erbrachten Arbeitsleistung und der hierfür vereinbarten Vergütung schon dann anzunehmen, wenn diese nicht einmal zwei Drittel eines in der betreffenden Branche und Wirtschaftsregion üblicherweise gezahlten Tariflohns oder - wenn ein Tariflohn nicht existiert oder nicht der verkehrsüblichen Vergütung entspricht - des allgemeinen Lohnniveaus in dem betreffenden Wirtschaftsgebiet erreiche.
Vergütung sogar unterhalb der einer Fachangestellten
Eine Vergütung des angestellten Rechtsanwalts, die sogar das durchschnittliche Anfangsgehalt eines Rechtsanwalts- und RENO-Fachangestellten unterschreite, sei nicht mit § 26 BORA vereinbar. Die in der Anzeige angebotene Vergütung liegt aber unter diesem Gehalt. Nach dem Merkblatt des Deutschen Anwaltsvereins belaufe sich die Vergütung eines ausgebildeten Rechtsanwalts- und RENO-Fachangestellten auf 1.200 € bis 1.500 € im ersten und auf 1.300 € bis 1.700 € im zweiten bis vierten Berufsjahr. Das in Aussicht gestellte Gehalt bewege sich mithin im untersten Bereich der Vergütung, die ein Rechtsanwalts- und RENO-Fachangestellter erhalte. Auch wenn der angestellte Rechtsanwalt zu Beginn der Tätigkeit zu Ausbildungszwecken teilweise mit Aufgaben betreut werden soll, die sonst von einem Rechtsanwalts- und RENO-Fachangestellten wahrgenommen werden, stehe dies zu der geforderten Gegenleistung, die nach Abschluss der Einarbeitungsphase überwiegend in rechtsanwaltlicher Tätigkeit bestünde, in einem auffälligen Missverhältnis.