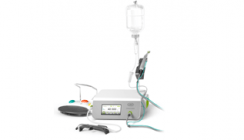Branchenmeldungen 30.11.2023
Der Umgang mit Diabetes in der Zahnmedizin – Teil 1
share
Die Aufgabe als Dentalhygienikerin umfasst nicht nur die Prophylaxe und Parodontaltherapie, sondern beschäftigt sich zudem mit der gesamten Gesundheit des Patienten. So ist es wichtig, vor jeder Behandlung eine ausführliche Anamnese durchzuführen und diese auch regelmäßig zu aktualisieren, um zielgerecht und individuell auf alle möglichen Erkrankungen eingehen zu können. Dies wird auch im Individual Prophy Cycle von W&H, der mit Prof. Dr. Dirk Ziebolz und Dr. Gerhard Schmalz erarbeitet wurde, empfohlen.
Insbesondere bei Diabetespatienten sollten Ansätze und Maßnahmen verfolgt werden, um die allgemeine Mundgesundheit besonders zu stärken und zu fördern. Die negativen Auswirkungen vorgenannter Erkrankung auf die Mundhöhle sind hinreichend erforscht und nachgewiesen (Sanz, et al., 2017). Hierbei sollte bei jeder Sitzung der aktuelle HbA1c-Wert vorliegen. Bezugnehmend auf den Artikel Biologische und klinische Assoziationen von oraler Gesundheit und Diabetes (Schmalz et al., 2022) können Empfehlungen auch im Praxisalltag umgesetzt werden. Für die Zahnarztpraxis sind drei Diabetes-Typen von Relevanz:
Diabetes Typ I und Typ II sowie der Gestationsdiabetes
Diabetes Typ I
Beim Diabetes Typ I, auch juveniler Diabetes genannt, zerstören die körpereigenen Antikörper die insulinproduzierenden Betazellen (Langerhans-Insel-Zellen), was zur Folge hat, dass ein Insulinmangel vorliegt. Diese Autoimmunerkrankung ist meist angeboren, wird oftmals bereits im frühen Alter erkannt und die Erkrankten müssen lebenslang Insulin zuführen.
Diabetes Typ II
Hierbei handelt es sich um einen erworbenen Diabetes, welcher sich meist im Alter zurückführend aufgrund ungesunder Lebensweise entwickelt. Es kommt zu einer Insulinresistenz, auf welche die Zellen nicht mehr auf das Hormon Insulin reagieren. Die Ursachen sind Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung sowie Übergewicht. Durch eine Anpassung der Ernährungs- und Lebensgewohnheiten kann man auf Diabetes Typ 2 Einfluss nehmen.
Gestationsdiabetes
Diese Diabetesart entsteht durch eine abnehmende Insulinempfindlichkeit bei Schwangeren, welche zwischen der 24. und 28. Schwangerschaftswoche auftritt. Zwar liegt die Prävalenz nur bei einem sehr geringen Anteil von 5 % und der Zuckerstoffwechsel normalisiert sich in den meisten Fällen nach der Geburt wieder. Trotzdem gilt aber zu beachten, dass das künftige Diabetesrisiko deutlich erhöht bleibt. Alle Diabetes-Typen schädigen durch die hohen Blutzuckerwerte die Blutgefäße, Nerven als auch zahlreiche Organe (DGParo, 2023).
Eine Diabeteserkrankung zeichnet sich über einen dauerhaft erhöhten Blutglukosespiegel aus, welche auch eine Vielzahl an Assoziationen mit verschiedenen Erkrankungen in der Mundhöhle zur Folge hat. Karies, Mundschleimhautveränderungen wie Candida-Infektionen (Guggenheimer, et al., 2000); (Petrou-Amerikanou et al., 1998), Wundheilungsstörungen oder Xerostomie sind hier nur einige wenige davon. Außerdem kommt es zur Diabetes-assoziierten Hyperglykämie mit Steigerung der lokalen und systemischen Inflammation, welches zur Apoptose und zu oxidativem Stress führt (Brownlee, 2005). Zudem besteht auch ein Risiko für makro- und mikrovaskuläre Komplikationen. Somit stehen die beiden Erkrankungen Parodontitis und Diabetes hier in einer bidirektionalen Beziehung zueinander (DGParo, 2023). Diabetes gilt hierbei als Prädispositionsfaktor für Parodontitiserkrankungen. So kann bei einem schlecht eingestellten Diabetiker die Schwere der Parodontitiserkrankung ausgewiesen sein, umgekehrt aber eine verbesserte glykämische Kontrolle nach Parodontaltherapie beschrieben werden. Bei Diabetes- und Parodontitiserkrankten sind folgende Entzündungsmarker von Relevanz: Interleukin 6 (IL-6), Tumornekrosefaktor-alpha (TNF-ɑ) und das durch die induziertes Akute-Phase-Protein (C-reaktives Protein). Überdies ist ein verstärkter parodontaler Gewebeabbau zwecks Aktivierung der Matrix-Metalloproteinasen eine häufige Begleiterscheinung. Insgesamt kann somit zusammenfassend gesagt werden, dass Diabetiker eine raschere, schwerere und fortschreitendere parodontale Inflammation und Destruktion infolge von erhöhten Attachmentverlusten, Sondierungstiefen und Risiken für Zahnverluste aufweisen (Kocher et al., 2018).
Regelmäßige Checks und individuelle Pflegeanleitung
So sollten in regelmäßigen Abständen intraorale Befunde bestimmt werden, um frühzeitig Veränderungen zu erkennen. Die Mundschleimhaut sollte bei jeder Sitzung sorgfältig abgetastet und visuell auf Veränderungen diagnostiziert werden. Parodontalbefunde und Röntgenbilder sollten in regelmäßigen Abständen erstellt werden, um den aktuellen parodontalen Zustand sowie den fortschreitenden Verlauf präzise einschätzen zu können. Der Patient wird außerdem in der Dentalhygiene ausführlich über eine adäquate Mundhygiene instruiert und bestmöglich aufgeklärt. So sollten neben einer elektrischen Zahnbürste auch andere Hilfsmittel wie Interdentalbürstchen, Zahnseide oder Zungenreinigung mit in die tägliche Zahnpflege-Routine integriert werden. Ergänzend sollte der Fokus um eine gesunde und ausgewogene Ernährung erweitert werden. So sind hochglykämische Kohlenhydrate, gesättigte Fettsäuren und industriell verarbeitete Produkte möglichst zu vermeiden. Gemüse und Obst sowie Antioxidantien sollten hierbei favorisiert und mit in den täglichen Speiseplan aufgenommen werden. Sollten die Patienten betagt sein, empfiehlt es sich außerdem, Bezugspersonen mit einzubeziehen. Zudem können Rücksprachen mit den behandelnden Internisten hier oftmals sehr hilfreich und zielführend sein. Abschließend empfiehlt es sich, nach jeder Prophylaxesitzung, einen individuellen und engmaschigen Recall (bedarfsorientiert, risikoorientiert) anzustreben. Die Patienten sind hier oftmals froh über eine ausreichende Aufklärung, da ihnen das Ausmaß der Erkrankung im Zusammenhang mit der Mundgesundheit oftmals nicht bewusst ist. Insbesondere die pathogenen Mechanismen beeinflussen die Entstehung und Progression bei Parodontalerkrankungen und haben oftmals eine Vielzahl an Wechselwirkungen mit systemischen Erkrankungen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass auf Diabetespatienten ein besonderes Augenmerk gelegt werden sollte. Diese Patienten sollten sehr ausführlich über die Zusammenhänge der Erkrankung und der Mundgesundheit aufgeklärt werden. Zudem empfiehlt sich auch ein engmaschigerer Recall.
Dieser Beitrag ist unter dem Originaltitel: „Diabetes in der Zahnmedizin – Teil 1“ im PJ Prophylaxe Journal erschienen.