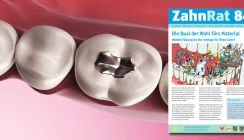Wissenschaft und Forschung 17.03.2015
Wie gelingen stabilere Zahnfüllungen?
Es gibt nicht nur unterschiedliche Materialien für Zahnfüllungen, sondern auch unterschiedliche Methoden, um das Füllmaterial anzurühren. Welche Zubereitung zum besten Ergebnis führt, ist nicht leicht herauszufinden.
Ein Team aus Kopenhagen hat nun einen Weg gefunden, diese Frage für eine wichtige Klasse von Zahnfüllmaterialien zu beantworten: Sie untersuchten unterschiedlich angerührte Zahnfüllungen auf Basis eines Glasionomerzements mit Röntgen- und Neutronentomografie am HZB. Ihre Ergebnisse zeigen, dass die Zubereitung eine große Rolle spielt, um flüssigkeitsgefüllte Poren zu vermeiden, die die Stabilität der Füllung verringern. Die Arbeit ist nun in Scientific Reports publiziert.
Künstliche Zahnfüllungen müssen viel aushalten, nicht nur Säuren und Bakterien im Mund, sondern vor allem auch riesige mechanische Kräfte. Klassische Amalgam-Füllungen sind wegen ihres Quecksilbergehalts unbeliebt, neuere Kunststoff-Komposite halten den Belastungen häufig nicht ausreichend lange stand.
Ein interdisziplinäres Team des Niels
Bohr-Instituts an der Universität Kopenhagen forscht daher an
Glasionomerzement, einem Füll-Material, das ohne Quecksilber auskommt,
biologisch verträglich und einfach zu verarbeiten ist. „Wir untersuchen
die Beziehung zwischen der Mikrostruktur des Materials und seiner
Belastbarkeit, damit wir diese Eigenschaften verbessern können“, sagt
Ana Benetti, Zahnärztin und Wissenschaftlerin an der Universität
Kopenhagen. Dabei wird Glasionomerzement als Pulver einfach mit einer
Flüssigkeit angerührt, eine spezielle Laborausrüstung ist nicht nötig. Zudem härtet die Füllung von selbst aus und muss nicht wie die
Komposit-Füllungen mit einer UV-Lampe gehärtet werden. Diese einfache
Handhabung ist ein Vorteil bei der Behandlung von Patienten in
ländlichen Regionen Afrikas, Chinas oder Südamerikas, die nicht ans
Stromnetz angeschlossen sind.
Säuren in den Zement oder besser ins Wasser?
Das Material lässt sich auf mehreren Wegen zu einer Zahnfüllung verarbeiten: Das Zementpulver kann entweder mit einer Wasser-Säure Mischung angerührt werden oder es wird schon vorab mit einer Mischung aus Säuren versetzt, so dass normales Wasser zum Anrühren ausreicht. Die Frage war nun: Was ist der beste Weg, um eine stabile Füllung zu erreichen?
„Dabei ist es OK, wenn die Zahnfüllungen eine gewisse Anzahl von Poren aufweisen“, erklärt Heloisa Bordallo, Materialforscherin an der Universität Kopenhagen. „Problematisch wird es dann, wenn Poren mit Flüssigkeit gefüllt sind, denn dann brechen die Füllungen leichter.“ Um diese Frage zu untersuchen, nahmen sie Kontakt zu Nikolay Kardjilov und Ingo Manke auf, die Experten für 3-D-Bildgebung mit Neutronen- und Röntgentomographie am BER II des Helmholtz-Zentrums Berlin sind.
Maximaler Durchblick mit Neutronen- und Röntgentomographie
„Unser Instrument CONRAD II ermöglicht die weltweit höchste räumliche Auflösung mit Neutronen, vergleichbar mit der Auflösung, die wir mit der Röntgen-Mikrocomputertomografie erreichen, die wir hier auch durchführen“, erklärt Kardjilov. Um die Position und Größe der Poren in den unterschiedlich angerührten Füllungen zu ermitteln, fertigten sie zuerst CT-Aufnahmen in 3-D an. Die anschließende Neutronentomografie ermöglichte dann, die Verteilung von Wasserstoffatomen und Flüssigkeit im Material und insbesondere in den Poren zu erkennen.
Stabilere Füllungen mit „saurem“ Wasser
Die Ergebnisse zeigen, dass der „einfachste Weg“ nicht der beste ist: Wenn der Zement bereits mit Säuren vermischt ist und nur noch mit Wasser angerührt werden muss, kommt es zu Poren, die Flüssigkeit enthalten. „Wir erhalten ein stabileres Material, wenn wir das Zementpulver mit einer Mischung aus Säuren und Wasser anrühren. Es ist besser, die Säuren im Wasser zuzugeben – es hilft, die Flüssigkeit schneller zu binden, so dass weniger Wasser in Poren eingelagert wird“ erklärt Heloisa Bordallo.
Dennoch ist noch in beiden Fällen zu viel Flüssigkeit
in den Poren, die Forschung an der idealen Mischung für die perfekte
Zahnfüllung geht weiter.
Die Ergebnisse sind im Open Access Journal Scientific Reports publiziert mit der doi: 10.1038/srep08972
Quelle: HZB Helmholtz Zentrum Berlin