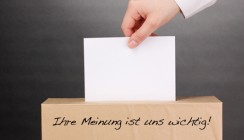Recht 13.08.2013
Fit für die Patientenaufklärung?
share
Folge einer unzureichenden oder nicht dokumentierten Aufklärung ist, dass der Zahnarzt für die Behandlung bzw. für die aufgrund dieser Behandlung entstandenen Schäden zivilrechtlich haftet, ohne dass ihm tatsächlich ein Behandlungsfehler unterlaufen sein muss. Mangels Aufklärung ist der Behandlungsvertrag in diesem Fall nicht wirksam zwischen Zahnarzt und Patient zustande gekommen.
Wie bereits beschrieben, stellt der Eingriff durch den Zahnarzt eine nichtgerechtfertigte Körperverletzung des Patienten dar. Erschwerend kommt in diesen Fällen hinzu, dass der Zahnarzt in einem Haftungsprozess die Aufklärung und deren Umfang beweisen muss. Kann der Zahnarzt die Aufklärung nicht beweisen, dann geht das Gericht zu dessen Lasten davon aus, dass die Aufklärung nicht erfolgt ist. Dies hat man nun versucht im Patientenrechtegesetz zu normieren. Mit viel Beachtung wurde das Patientenrechtegesetz bereits im Vorfeld diskutiert. Egal ob Boulevardblatt oder „seriöse“ Tageszeitung, egal ob Politiker oder Funktionär, letztlich hatte jeder eine Meinung zu der Gesetzesänderung. Das Patientenrechtegesetz sollte nach dem Willen des Gesetzgebers unter anderem die Rechte der Patienten stärken, Transparenz schaffen und die Patienteninformation verbessern. Die in den neuen §§ 630 a ff. BGB geregelten Pflichten scheinen jedoch nur Rechte und Pflichten wiederzugeben, die bislang durch die Rechtsprechung zur (Zahn-)Arzthaftung, dem Grundgesetz, der Berufsordnung der Ärzte und weiteren Gesetzen bereits geregelt wurden. Ob Sie diese alle kennen, können Sie nachfolgend überprüfen.
Zunächst ist grundlegend zwischen der sogenannten Sicherheits- oder therapeutischen Aufklärung einerseits und der Eingriffs- und Risikoaufklärung andererseits zu unterscheiden. Eine dritte Fallgruppe beschäftigt sich mit der wirtschaftlichen Aufklärung.
Die therapeutische Aufklärung
Die therapeutische Aufklärung beinhaltet die Beratung über therapierichtiges Verhalten, beispielsweise also über eine etwaige Mitwirkung des Patienten, oder die rechtzeitige Einleitung einer sachgerechten Nachbehandlung. Sofern hier Versäumnisse erfolgten, so hat die Rechtsprechung dies bisher nicht als Aufklärungsfehler gewertet, sondern als Behandlungsfehler. Dies war insofern entscheidend, als Behandlungsfehler – im Gegensatz zu Aufklärungsfehlern – von Patienten zu beweisen sind. Die therapeutische Aufklärung, wie die Rechtsprechung sich entwickelt hat, ist nunmehr in § 630 c Absatz 2 BGB schriftlich niedergelegt. Hier heißt es nun wörtlich:
„Der Behandelnde ist verpflichtet, dem Patienten in verständlicher Weise zu Beginn der Behandlung und, soweit erforderlich, in deren Verlauf sämtliche für die Behandlung wesentlichen Umstände zu erläutern, insbesondere die Diagnose, die voraussichtliche gesundheitliche Entwicklung, die Therapie und die zu und nach der Therapie zu ergreifenden Maßnahmen.“ Gesetzlich geregelt ist also nunmehr nicht mehr, als die Rechtsprechung bisher bereits an Pflichten für die therapeutische Aufklärung konkretisiert hatte. Es stellt sich die Frage, ob hier nicht sogar von einem weniger auszugehen ist. Das Gesetz spricht im Zusammenhang mit der therapeutischen Aufklärung nunmehr nicht von Aufklärung, sondern von „erläutern“ und siedelt diese Pflicht nicht in Rahmen von § 630 e unter der Überschrift Aufklärungspflichten an, sondern im Rahmen der Informationspflichten, die juristisch gesehen ein „Weniger“ bedeuten.
Deutlich wird insofern auch, dass der Gesetzgeber klar davon ausgeht, dass sich Pflichtverletzungen aus dieser Norm nicht als Aufklärungsfehler, sondern als Behandlungsfehler darstellen, somit also die Beweislast beim Patienten verbleibt. Dies wird nochmals durch die Regelung des § 630 c Absatz 2 Satz 2 BGB unterstrichen, die insoweit eine wirkliche Neuerung bringt. Dieser lautet:
„Sind für den Behandelnden Umstände erkennbar, die die Annahme eines Behandlungsfehlers begründen, hat er den Patienten über diese auf Nachfrage oder zur Abwendung gesundheitlicher Gefahren zu informieren.“ Zwar war es auch bisher nicht erlaubt durch Inkaufnahme einer Gesundheitsgefährdung des Patienten Behandlungsfehler zu vertuschen, vielmehr hatte der (Zahn-)Arzt auch bereits vorher die Pflicht, gesundheitliche Gefahren des Patienten abzuwehren, auch wenn er dabei Umstände offenbart, die unter Umständen auf einen Behandlungsfehler schließen lassen. Neu hierbei ist jedoch, dass diese Information erst auf Nachfrage des Patienten zu erteilen ist und zwar auch dann, wenn es nicht zur Abwehr wesentlicher Gefahren erforderlich sein soll. Der (Zahn-)Arzt muss nach der neuen Norm nun also jeden Behandlungsfehler, auch wenn er nicht zu einer Gefährdung des Patienten geführt hat, auf Nachfrage des Patienten offenbaren. Dies umfasst dem Wortlaut nach nicht nur eigene Behandlungsfehler, sondern auch die fremder Kollegen. Selbst die Einräumung eigener Fehler ist unserer Rechtsordnung zumeist fremd und wird außer dem (Zahn-)Arzt nur noch dem Rechtsanwalt auferlegt. Um dies abzumildern und rechtsstaatliche Grundsätze zu wahren, hat der Gesetzgeber sich dann zur Abmilderung durch Satz 3 des § 630 c Abs. 2 entschieden, welcher ein Beweisverwertungsverbot für Straf- und Bußgeldverfahren regelt und lautet:
„Ist dem Behandelnden oder einem seiner in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen ein Behandlungsfehler unterlaufen, darf die Information nach Satz 2 zu Beweiszwecken in einem gegen den Behandelnden oder gegen seinen Angehörigen geführten Straf- oder Bußgeldverfahren nur mit Zustimmung des Behandelnden verwendet werden.“
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass der Behandler wie bisher ungefragt über Behandlungsfehler informieren muss, sofern dies zur Abwendung gesundheitlicher Gefahren erforderlich ist. Hinzu kommt, dass er auf Nachfrage sogar erkennbare eigene und fremde Fehler offenbaren muss, auch wenn dies nicht für die Abwendung gesundheitlicher Gefahren erforderlich ist. Auch sofern die Aufklärung Mängel in wirtschaftlicher Hinsicht hatte, der Patient mithin nicht oder nicht genügend über die Kosten der Behandlung aufgeklärt war, hatte die Rechtsprechung als Nebenpflicht des mit dem (Zahn-)Arzt geschlossenen Behandlungsvertrags eine wirtschaftliche Aufklärungspflicht entwickelt. Aufklärungsmängel in diesem Zusammenhang musste der Patient beweisen. Nun ist dies in § 630 c Absatz 3 BGB gesetzlich geregelt. „Weiß der Behandelnde, dass eine vollständige Übernahme der Behandlungskosten durch einen Dritten nicht gesichert ist oder ergeben sich nach den Umständen hierfür hinreichende Anhaltspunkte, muss er den Patienten vor Beginn der Behandlung über die voraussichtlichen Kosten der Behandlung in Textform informieren. Weiter gehende Formanforderungen aus anderen Vorschriften bleiben unberührt.“
Ausnahmen von dieser wirtschaftlichen Aufklärungspflicht normiert Absatz 4 der Vorschrift, für den Fall, dass die Behandlung unaufschiebbar ist oder der Patient auf die wirtschaftliche Aufklärung verzichtet hat. Insoweit entspricht die gesetzliche Vorschrift der hierzu in den vergangenen Jahren ergangenen Rechtsprechung und bedeutet keine Änderung des Aufklärungsverhaltens.
Die Eingriffs- und Risikoaufklärung
Die ursprüngliche Eingriffs- und Risikoaufklärung, also die Aufklärung im klassischem Sinne, hat der Gesetzgeber dann in § 630 e BGB geregelt. Absatz 1 Satz 1 legt dem Behandler die Pflicht auf, den Patienten über alle „für die Einwilligung wesentlichen Umstände“ aufzuklären. Hierzu soll nach Absatz 1 Satz 2 dieser Vorschrift auch und insbesondere gehören, dass über Art, Umfang, Durchführung, zu erwartende Folgen und Risiken der Maßnahme sowie Notwendigkeit und Dringlichkeit, Eignung und Erfolgsaussichten im Hinblick auf Diagnose und Therapie aufgeklärt wird. Hierbei soll der (Zahn-)Arzt auch auf Alternativen zur Maßnahme hinweisen, wenn mehrere gleichermaßen indizierte und übliche Methoden zu wesentlichen unterschiedlichen Belastungen, Risiken und Heilungschancen führen können. Auch diese gesetzliche Normierung bietet nichts Neues und manifestiert nur bisherige ständige Rechtsprechung. Im Bereich der Wurzelbehandlung hatte diese insoweit festgelegt, dass der Zahnarzt über alle mit der Wurzelbehandlung typischen Schäden aufzuklären hat. Was hierunter zu verstehen ist, hat die Rechtsprechung in Einzelfallentscheidungen herausgearbeitet. Vor einer Wurzelbehandlung müssen Zahnärzte hiernach aufklären über – leichte bis heftige Schmerzen kurz nach der Wurzelbehandlung für einige Stunden oder Tage,
- unvollständige, nicht bis zum Ende der Wurzelspitze durchgängige Wurzelkanäle,
- unvollständige Wirkung der Betäubung, – Schwellung/Abszesse kurz nach der Wurzelbehandlung oder später,
- Abbrechen von Wurzelkanalinstrumenten im Wurzelkanal,
- Verletzung des Gewebes an der Wurzelspitze,
- Überfüllung von Wurzelkanälen bzw. Austreten des Füllmaterials aus der Wurzelspitze,
- zusätzliche unnatürliche Zahnöffnungen durch das Aufbohren,
- die Verfärbung bzw. das Abdunkeln des wurzelgefüllten Zahns,
- Absplitterungen, Abbrechen oder Zerbrechen wurzelgefüllter Zähne,
- Fortbestehen bzw. erneutes Auftreten von Schmerzen oder Beschwerden.
Insbesondere in der zahnheilkundlichen Praxis hatte die Rechtsprechung eine Aufklärungspflicht bei alternativen Behandlungsmöglichkeiten bereits als Standard erachtet. Dies auch, wenn der Zahnarzt die von ihm gewählte Behandlungsmethode favorisierte. So hatte das OLG Koblenz mit Urteil vom 04.04.2000 – 1 U 1295/98 eine Verletzung der Aufklärungspflicht einer Zahnärztin bejaht, die sich bei einer Wurzelzyste für ein chirurgisches Vorgehen durch Wurzelspitzenresektion und Wurzelspitzenkürzung entschieden. Der Sachverständige hatte dann festgestellt, dass eine konservative Therapie durch Trepanation des Zahnes und Wurzelkanalbehandlung eine vergleichbare Erfolgsaussicht gehabt hätte, wobei das Risiko der Verletzung des Unterkiefernervs erheblich geringer gewesen wäre. Das OLG Köln hatte mit Urteil vom 30.09.1998 – 5 U 122/97 ebenfalls eine Aufklärungspflichtverletzung angenommen, weil als Alternative zu einer vorgenommenen zahnprothetischen Oberkieferversorgung mittels einer Gaumenplatte auch eine teleskopierende, bügelfreie Brückenprothese mit einer nur auf dem Kieferkamm ausgedehnten Gerüstauslegung in Betracht kam. Die Voraussetzungen für gute parodontale Verankerung der Restzähne und ein ausreichend ausgeprägter Alveolarfortsatz waren hierbei gegeben. Eine Verpflichtung zur Aufklärung wurde vom OLG Stuttgart mit Urteil vom 02.01.1997 – 14 U 10/96 bereits angenommen, wenn verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten für eine Oberkieferprothese wegen der unterschiedlichen Missempfindungen und Gewöhnungsprobleme zu jeweils unterschiedlichen Belastungen für den Patienten führen. Wird eine inzwischen weniger gebräuchliche und risikobehaftetere Methode angewandt und gibt es eine Behandlungsalternative, so muss erst recht aufgeklärt werden. Dies hat das OLG Stuttgart mit Urteil vom 17.04.2001 – 14 U 74/00 für den Fall entschieden, dass ein subperiostales statt einem enossalen Implantat verwendet werden sollte, der Patient jedoch nicht darauf hingewiesen wurde, dass bei einem subperiostalen Implantat das Risiko einer chronischen Entzündung besteht, die Misserfolgsquote deutlich höher als beim enossalen Implantat ist und bei einer Entzündung das komplette Implantat entfernt werden muss, wohingegen das beim enossalen Implantat nur für den betroffenen Teil gilt. § 630 c Absatz 2 BGB regelt nun die Form der Aufklärung, die wie bisher nur mündlich erfolgen muss. Ergänzend kann auf schriftliche Unterlagen Bezug genommen werden. Neu hierbei ist, dass der Patient die Unterlagen, auf die Bezug genommen wird, auch in Textform ausgehändigt bekommen muss. Dabei ist dringend zu empfehlen, sich die Aushändigung und die Erläuterung zu Dokumentationszwecken quittieren zu lassen. Die Aufklärung muss nach Absatz 2 Nr. 2 außerdem rechtzeitig erfolgen.
Was hierunter zu verstehen ist, ist eine Frage des Einzelfalles, mit der sich die Rechtsprechung auch bereits in der Vergangenheit beschäftigt hat. Bei der Umsetzung dieses Grundsatzes in die Praxis ist allerdings zu berücksichtigen, dass sich Unterschiede zwischen einem Eingriff im Rahmen eines stationären Krankenhausaufenthalts und einer ambulanten Behandlung ergeben können. Bei einem Eingriff mit stationärem Krankenhausaufenthalt, im zahnheilkundlichen Bereich etwa ein größerer kieferchirurgischer Eingriff, ist die Aufklärung grundsätzlich schon dann vorzunehmen, wenn der Zahnarzt zum operativen Eingriff rät und zugleich einen festen Operationstermin vereinbart. Sofern der Eingriff geringe Risiken oder wenig einschneidende Risiken beinhaltet, kann allerdings eine Aufklärung am Tag vor der Operation noch rechtzeitig sein (BGH vom 14.06.1994 VI ZR 178/93). Dies gilt auch bei größeren ambulanten Operationen mit beträchtlichen Risiken, wie sie etwa bei der Entfernung von Weisheitszähnen oder einer vollständigen Gebisssanierung gegeben sein können. Hingegen reicht es bei normalen ambulanten Eingriffen, die in der zahnärztlichen Praxis die Regel darstellen dürften, grundsätzlich aus, wenn die Aufklärung am Tag des Eingriffs erfolgt. Jedoch muss in jedem Fall gewährleistet sein, dass der Patient eine eigenständige Entscheidung darüber treffen kann, ob er den Eingriff durchführen lassen will oder nicht (BGH Urteil vom 04.04.1995 – VI ZR 95/94). Bei einem normalen Narkoserisiko, wie etwa bei der zahnärztlich üblichen Leitungsanästhesie, wurde bisher eine Aufklärung am Vorabend einer Operation als ausreichend angesehen (BGH Urteil vom 07.04.1992 – VI ZR 192/91).
Des Weiteren muss die Aufklärung nach § 630 e Absatz 2 Nr. 3 BGB für den Patienten verständlich sein. Dies bedeutet laut der Gesetzesbegründung, dass die Aufklärung in einer Sprache zu erfolgen hat, die der Patient versteht. Im Zweifel sollte ein Dolmetscher herangezogen werden. Ist dies nicht möglich, kann die Aufklärung nicht wirksam erfolgen und die Behandlung ist zu unterlassen. Dem Patienten sind des Weiteren Abschriften von Unterlagen, die er im Zusammenhang mit der Aufklärung oder Einwilligung unterzeichnet hat, auszuhändigen. § 630 e Absatz 3 BGB regelt wiederum Ausnahmen zur Aufklärungspflicht. Diese kann unterbleiben, sofern die Behandlung unaufschiebbar ist oder der Patient ausdrücklich verzichtet. Insoweit ist § 630 e inhaltsgleich mit § 630 c. Ist der Patient nicht einwilligungsfähig, so ist nach § 630 e Absatz 4 BGB die Aufklärung gegenüber einem zur Einwilligung Berechtigten gegenüber vorzunehmen. Hierbei ist zu beachten, dass die Einwilligungsfähigkeit keine zivilrechtliche Geschäftsfähigkeit voraussetzt. Einwilligungsfähigkeit ist nach der Rechtsprechung dann gegeben, wenn der Patient im Hinblick auf den anstehenden Eingriff nach seiner natürlichen Einsichts- und Steuerungsfähigkeit die Bedeutung, Tragweite und Risiken erfassen und seinen Willen hiernach bestimmen kann. Die Beurteilung der Einwilligungsfähigkeit obliegt dem behandelnden Arzt. Im Grundsatz lässt sich formulieren, dass je komplexer und risikoreicher die Behandlung ist, desto höher die Anforderungen an die Einwilligungsfähigkeit des Patienten zu stellen sind. Wer im Falle der Einwilligungsunfähigkeit als Berechtigter anzusehen ist, ist häufig schwierig. Fehlerhaft ist jedenfalls einfach davon auszugehen, dass dies die nächsten Angehörigen sind. Bei Einwilligungsunfähigkeit des Patienten kann unter Umständen die Pflicht des Arztes entstehen, eine Betreuung nach § 1896 BGB beim zuständigen Betreu ungsgericht anzuregen. Neben die Aufklärung des Berechtigten tritt gemäß § 630 e Absatz 5 BGB auch die Pflicht des Zahnarztes, auch den Einwilligungsunfähigen entsprechend seinem Verständnis aufzuklären. Diese Vorschrift wurde insbesondere eingeführt, da der BGH bisher von einem Vetorecht minderjähriger, einwilligungsunfähiger Patienten ausging, sofern der Eingriff nur relativ indiziert war und die Möglichkeit erheblicher Folgen für die weitere Lebensführung barg (BGH Urteil vom 10.10.2006 – VI ZR 74/05). Eine nur relative Indikation liegt zum Beispiel bei der Weisheitszahnextraktion vor. Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass das Patientenrechtegesetz in puncto Aufklärung keinerlei nennenswerten Neuerungen bringen wird, sondern nur die gesetzlich normierte Form der bisherigen obergerichtlichen Rechtsprechung darstellt.
Praxishinweis
Der Schlüssel der zahnärztlichen Aufklärungspflichten liegt in der Dokumentation, diese kann helfen ihn zu exkulpieren, da sie zumindest den Anscheinsbeweis für eine erfolgte Aufklärung bietet. Da die Pflichten des Zahnarztes in puncto Aufklärung mannigfaltig sind und dieser Artikel nur einen kleinen Überblick bieten kann, ist im Zweifel auf rechtliche Hilfe zurückzugreifen.